Im deutschen Schulsystem sind Migrantenfamilien keine Randgruppe mehr - sie sind ein zentraler Teil der Bildungslandschaft. Mehr als ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. In Berlin liegt der Anteil bei fast der Hälfte. Doch trotz dieser Zahlen bleibt die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus oft unzureichend, unklar oder gar fehlend. Warum? Weil viele Schulen noch immer mit Standardbriefen, Deutsch-only-Informationen und einer passiven Haltung arbeiten, statt echte, kultursensible Beziehungen aufzubauen.
Warum die Kommunikation scheitert - und was wirklich dahintersteckt
Viele Lehrkräfte denken: „Wir haben doch einen Elternbrief in Türkisch, Arabisch und Polnisch geschickt.“ Doch das ist nicht Kommunikation. Das ist eine Geste. Echte Kommunikation beginnt mit Verständnis. Die Forschung des ISEKIM-Projekts an der Universität Bremen zeigt: Die größten Hürden liegen nicht nur in der Sprache, sondern in drei tiefen Schichten. Erstens: Sprachliche Barrieren. 62 Prozent der Migranteneltern haben nur geringe oder keine Deutschkenntnisse. Das ist kein Mangel an Motivation - das ist eine strukturelle Lücke. Zweitens: Kulturelle Unterschiede. In einigen Herkunftsländern gilt es als respektlos, Lehrkräfte zu hinterfragen. In anderen wird Bildung als staatliche Pflicht verstanden, nicht als gemeinsame Verantwortung. Drittens: Vertrauensverlust. Viele Familien haben in ihren Heimatländern schlechte Erfahrungen mit Bildungsinstitutionen gemacht - und diese Erinnerungen reisen mit. Dazu kommt: Schulen sind oft überlastet. 73 Prozent der Lehrkräfte sagen, sie haben einfach keine Zeit, um tiefgehende Gespräche mit Eltern zu führen. Und wenn sie es versuchen, fehlt ihnen die Schulung. 68 Prozent der Schulen bieten keine Fortbildungen zu interkultureller Kommunikation an.Was funktioniert - und was nicht
Frühere Ansätze, wie das „Integrationslotsen“-Programm, setzten auf Einzelpersonen, die zwischen Schule und Familie vermitteln. Doch diese Modelle sind anfällig für Überlastung und fehlen oft an Kontinuität. Die Lösung liegt nicht in Einzelpersonen, sondern in Systemen. Das ISEKIM-Projekt hat gezeigt: Was wirklich wirkt, sind mehrsprachige, kontextbezogene Materialien. Keine Übersetzungen von deutschen Elternbriefen - sondern eigene Inhalte, die auf die Lebensrealitäten der Familien zugeschnitten sind. Ein Video, das erklärt, wie man sich an der Schule anmeldet, in Dari, Farsi oder Ukrainisch, mit Bildern statt nur Text. Ein Blogbeitrag, der erklärt, warum Kinder in Deutschland ab der 4. Klasse in verschiedene Schulformen gehen - und warum das nicht bedeutet, dass sie „nicht gut genug“ sind. Diese Materialien wurden nicht von Experten allein entwickelt - sondern gemeinsam mit Migranteneltern. 100 Prozent der Inhalte entstanden in Ko-Kreation. Ein Vater aus Syrien half bei der Übersetzung der Erklärung zum Zeugnis. Eine Mutter aus der Ukraine zeigte, wie man den Begriff „Bildungsgespräch“ in ihrer Sprache verständlich macht. Das ist kein „Diversity-Check“ - das ist echte Partizipation.
Praktische Schritte für Schulen - von der Theorie zur Umsetzung
Es gibt keine magische Formel. Aber es gibt klare, umsetzbare Schritte, die jede Schule beginnen kann - ohne große Budgets, aber mit klarem Willen.- Identifizieren Sie die Sprachen Ihrer Elternschaft. Sammeln Sie Daten - nicht nur über Herkunftsländer, sondern über tatsächliche Sprachkenntnisse. Nutzen Sie Anmeldeformulare, um zu fragen: „Welche Sprache sprechen Sie am liebsten zu Hause?“
- Bauen Sie eine mehrsprachige Informationsbasis auf. Nutzen Sie kostenlose Tools wie Google Translate als Startpunkt - aber übersetzen Sie nicht einfach. Fragen Sie Muttersprachler: „Ist das verständlich? Würden Sie das so lesen?“
- Verwenden Sie visuelle Kommunikation. Ein Bild von einem Schulplaner, mit Pfeilen, Icons und Farben, spricht mehr als ein halb übersetzter Text. In Grasberg haben Schulen mit geflüchteten Familien ohne Alphabetisierung erfolgreich mit Bildkarten gearbeitet - und Eltern konnten so an Elternabenden teilnehmen.
- Ermutigen Sie Familiensprachen. Ein Kind, das zu Hause Arabisch spricht, lernt Deutsch nicht langsamer - es lernt es besser. Lehrkräfte sollten sagen: „Ihr Kind spricht zu Hause Arabisch? Das ist ein Vorteil. Wir unterstützen das.“
- Benennen Sie eine Integrationsbeauftragte oder einen Integrationsbeauftragten. Jede Schule braucht mindestens eine Person, die 10 Prozent ihrer Arbeitszeit für Elternkommunikation mit Migrantenfamilien hat. Diese Person organisiert Treffen, übersetzt Materialien, vermittelt bei Konflikten und sammelt Feedback.
- Veranstalten Sie regelmäßige Feedbackrunden. Einmal pro Halbjahr: Eltern aus Migrationsfamilien treffen sich mit Lehrkräften und sagen: „Was funktioniert? Was nicht? Was fehlt?“ Keine Einladung mit Formular - sondern ein Gespräch bei Tee und Gebäck.
Die Rolle von Vertrauen - und wie man es aufbaut
Kommunikation ist nicht nur Informationsaustausch. Sie ist Beziehungsaufbau. Und Beziehung braucht Zeit - und Respekt. Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu sagt: „Vertrauen entsteht, wenn Eltern spüren, dass ihre Bildungsinteressen ernst genommen werden - und nicht als Problem gesehen werden.“ Das bedeutet: Wenn ein Kind schlechte Noten hat, geht es nicht darum, die Eltern zu beschuldigen. Es geht darum, gemeinsam zu fragen: „Was braucht Ihr Kind? Was können wir gemeinsam tun?“ Ein Beispiel: In einer Grundschule in Köln fragte eine Lehrerin nicht, warum die Mutter nicht zum Elternabend kam. Sie rief an. Die Mutter sagte: „Ich habe Angst, dass man denkt, ich bin dumm, weil ich kein Deutsch kann.“ Die Lehrerin lud sie zu einem persönlichen Gespräch ein - ohne andere Eltern. Sie zeigte ihr die Schulpläne mit Bildern. Sie bot an, ihr die nächste Elternversammlung vorab zu erklären. Nach drei Monaten kam die Mutter zum ersten Mal zu einem Elternabend - und fragte: „Können wir auch einen Elternrat gründen?“ Vertrauen entsteht nicht durch große Reden. Es entsteht durch kleine, konsistente Handlungen.
Die Zukunft: Was kommt als Nächstes?
Die Kultusministerkonferenz plant bis 2026 eine bundesweite Plattform für mehrsprachige Schulinformationen - basierend auf den Ergebnissen von ISEKIM. Das ist ein großer Schritt. Aber Technik allein reicht nicht. Die neue Generation von Migrantenfamilien - etwa die 415.000 ukrainischen Kinder, die seit 2022 in deutschen Schulen sitzen - haben oft gute Deutschkenntnisse, aber keine Ahnung vom deutschen Schulsystem. Sie brauchen nicht Übersetzungen - sie brauchen Erklärungen. Warum gibt es so viele Prüfungen? Warum wird in der 5. Klasse ein Zeugnis mit Noten gegeben? Warum muss ich mich bei der Schule anmelden, wenn mein Kind krank ist? Und dann ist da noch die Frage der Rassismus- und Diskriminierungserfahrung. Viele Eltern berichten, dass sie sich „wie Fremde“ fühlen, wenn sie in der Schule sind. Lehrkräfte müssen lernen, das anzusprechen - ohne zu beschuldigen. Ein Satz wie: „Ich weiß, dass es manchmal schwer ist, sich hier zuzugehörig zu fühlen. Wir wollen, dass Sie sich hier zu Hause fühlen.“ - kann Wunder bewirken.Was bleibt - und was wir nicht ignorieren dürfen
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Nur 41 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund wechseln auf das Gymnasium - gegenüber 58 Prozent ohne. Die Schulabbrecherquote liegt bei 8,7 Prozent statt 5,2 Prozent. Das ist kein Zufall. Das ist ein Systemfehler. Die Friedrich-Ebert-Stiftung warnt: „Wir dürfen nicht vergessen, dass auch Familien von Menschen mit Migrationshintergrund vom gesellschaftlichen Wandel betroffen sind.“ Sie sind nicht das Problem - sie sind Teil der Lösung. Es geht nicht darum, „Migrantenfamilien zu integrieren“. Es geht darum, Schulen zu integrieren - in die Realität eines vielfältigen Landes. Und das beginnt mit einer einfachen Frage: „Wie können wir mit Ihnen sprechen - nicht über Sie, sondern mit Ihnen?“Warum reichen einfache Übersetzungen von Elternbriefen nicht aus?
Einfache Übersetzungen ignorieren kulturelle Kontexte. Ein Brief, der in Deutsch sagt „Bitte kommen Sie zum Elternabend“, wird in einer anderen Sprache vielleicht wörtlich übersetzt - aber nicht verständlich. In einigen Kulturen wird eine Einladung als Pflicht verstanden, in anderen als optionale Gelegenheit. Außerdem fehlen oft Erklärungen zu Begriffen wie „Schulvertrag“, „Lehrerkonferenz“ oder „Bildungsplan“. Ohne Kontext ist die Übersetzung nutzlos.
Wie kann eine Schule anfangen, wenn sie kein Budget hat?
Man braucht kein Geld - man braucht Engagement. Nutzen Sie kostenlose Tools: Google Translate für grobe Übersetzungen, WhatsApp-Gruppen für schnelle Nachrichten, Fotos und Symbole für visuelle Kommunikation. Bitten Sie Schülerinnen und Schüler, Eltern zu übersetzen - aber nur, wenn es freiwillig ist. Wichtig ist: Machen Sie einen Anfang. Einmal im Monat ein Bild mit Erklärung in einer Sprache, die viele Eltern sprechen. Ein kurzes Video, aufgenommen mit dem Handy, in dem eine Lehrkraft erklärt, wie man die Hausaufgaben-App nutzt. Kleine Schritte führen zu großen Veränderungen.
Was ist, wenn Eltern nicht kommen - auch nach mehreren Einladungen?
Hören Sie nicht auf. Aber ändern Sie die Art, wie Sie einladen. Statt „Bitte kommen Sie zum Elternabend“ sagen Sie: „Wir haben ein Gespräch mit Ihnen geplant - wir kommen zu Ihnen nach Hause, wenn es Ihnen lieber ist.“ Oder: „Wir treffen uns am Samstag im Park - mit Kaffee und Gebäck, ohne Termin, ohne Druck.“ Viele Eltern kommen nicht, weil sie sich unwohl fühlen - nicht weil sie sich nicht interessieren. Die Schule muss sich anpassen - nicht die Familie.
Warum ist die Familiensprache wichtig für die schulische Entwicklung?
Kinder, die zu Hause ihre Familiensprache sprechen, entwickeln ein stärkeres Sprachbewusstsein. Sie lernen, wie Sprache funktioniert - Struktur, Ausdruck, Bedeutung. Dieses Wissen überträgt sich auf Deutsch. Forschung zeigt: Kinder, deren Eltern ihre Muttersprache stärken, lernen Deutsch schneller und sicherer. Wer die Familiensprache verbietet, schadet der Entwicklung - nicht hilft.
Wie kann man strukturellen Rassismus in der Schule ansprechen?
Indem man ihn benennt - und nicht ignoriert. Wenn ein Kind mit Migrationshintergrund oft als „unruhig“ oder „nicht motiviert“ bezeichnet wird, während gleichaltrige Kinder als „kreativ“ gelten, dann ist das Rassismus. Lehrkräfte brauchen Schulungen, um unbewusste Vorurteile zu erkennen. Eltern müssen wissen: „Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Kind wird anders behandelt - sagen Sie es. Wir hören zu.“ Ein offener Raum für diese Gespräche ist der erste Schritt zur Veränderung.



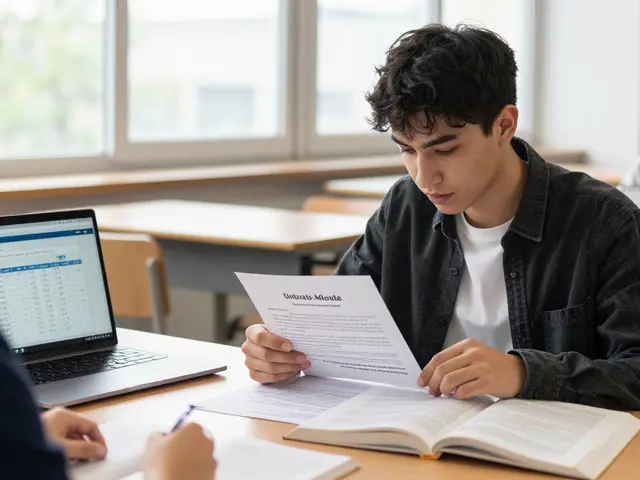



11 Kommentare
Gunnar Bye
Endlich mal jemand der’s sagt 😤 Die Schulen denken immer, Übersetzen reicht… nein, Kumpel, das ist wie wenn du einem Blinden ein Kochbuch in Chinesisch gibst und erwartest, dass er kocht. 🤦♂️
espen solheim
Ich hab das in meiner Schule so gemacht: Wir haben mit den Eltern ein Bilderalbum gebaut – jede Seite zeigt einen Schritt: Anmeldung, Elternabend, Zeugnis. Kein Text, nur Bilder. Die haben es verstanden. Einfach. Menschlich. 🙌
Kristine Lou
ich find das mega wichtig… aber wer macht das eigentlich? die lehrer haben doch schon 80 stunden die woche…
Olav Engh
Ich hab neulich mit einer ukrainischen Mutter geredet. Sie sagte: „Wir verstehen nicht, warum mein Sohn in die Realschule muss, obwohl er in der Ukraine immer die Beste war.“ Das ist das Problem. Nicht die Sprache. Das System. 🤔
Kristian Krokslett
Die genannten Maßnahmen sind empirisch fundiert und entsprechen den Empfehlungen des ISEKIM-Projekts. Eine systemische Integration erfordert strukturelle Anpassungen, nicht lediglich linguistische Übersetzungen. Die Ko-Kreation mit Eltern ist ein zentraler Bestandteil partizipativer Pädagogik und sollte als Standard etabliert werden.
Olav Finne
Das ist alles schön und gut, aber wer bezahlt die Integrationsbeauftragten? Wer schult die Lehrer? Wer übernimmt die Verantwortung, wenn es scheitert? Wir brauchen klare Verantwortungsstrukturen, keine Wohlfühl-Initiativen.
Even Ødegård
Ach ja, wieder die übliche Gutmenschen-Propaganda. Migranten sind doch nicht das Problem – nein, die Schule soll sich ändern. Aber warum nicht einfach die Eltern zwingen, Deutsch zu lernen? Dann wäre das Problem gelöst. Warum immer nur die Deutschen opfern?
Kathinka Haugsand
Interessant, dass hier alle so brav sind. Aber hat jemand mal dran gedacht, dass viele Migranteneltern gar nicht wollen, dass ihre Kinder hier aufwachsen? Dass sie nur wegen Geld hier sind? Und dass sie ihre Kinder gar nicht wirklich in das System integrieren wollen? 🤫
Gerhard Lehnhoff
Haha, wieder so ein Text, als ob wir alle in einer WG mit Syrern und Ukrainern leben. Die Schule ist kein Sozialarbeitsbüro! Wenn Eltern kein Deutsch können, ist das doch ihre Schuld. Warum muss ich als Lehrer jetzt noch Übersetzer spielen? 🤬 Ich hab doch auch Familie!
Geir Isaksen
Die ganze Diskussion ist soooo oberflächlich. Du glaubst wirklich, dass Bildkarten und WhatsApp-Gruppen den Bildungsungleichgewicht lösen? Das ist neoliberale Schönfärberei. Die echte Ursache ist der kapitalistische Bildungsmarkt, der Migrantenkinder systematisch aussortiert. Aber hey, lass uns lieber Bilder malen statt Strukturen angreifen. 😏
Jamie Baeyens
Du sprichst von Vertrauen, von Partizipation, von kleinen Handlungen… aber du vergisst eines: Die menschliche Würde. Es geht nicht darum, wie wir mit Migrantenfamilien kommunizieren. Es geht darum, ob wir sie überhaupt als Menschen anerkennen. Und das, meine Freunde, ist die letzte Grenze, die Deutschland noch nicht überwunden hat. 🕊️