Deutsch zu lernen ist nicht nur eine Schulpflicht für Kinder mit Migrationshintergrund - es ist der Schlüssel zum Leben in Deutschland. Wer Deutsch nicht spricht, hat Schwierigkeiten, einen Job zu finden, seine Kinder bei den Hausaufgaben zu unterstützen oder einfach nur beim Arzt verstanden zu werden. Doch das System, das dafür sorgen soll, funktioniert nicht für alle gleich gut. Es ist komplex, ungleich verteilt und oft mehr auf Defizite fokussiert als auf das, was Menschen bereits können.
Was ist eigentlich Deutsch als Zweitsprache (DaZ)?
Deutsch als Zweitsprache, kurz DaZ, bedeutet nicht, dass jemand Deutsch als Nebensprache lernt. Es bedeutet: Deutsch wird zur wichtigsten Sprache für den Alltag, für Schule, Arbeit und Sozialleben. Das ist besonders für Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund entscheidend. Laut Mikrozensus 2023 sprechen 77 Prozent der Bevölkerung zu Hause nur Deutsch. Aber fast ein Viertel der Menschen mit Einwanderungsgeschichte spricht zu Hause gar kein Deutsch - das sind rund 4,8 Millionen Menschen. Und von den 20,2 Millionen mit Migrationshintergrund sprechen nur 24 Prozent ausschließlich Deutsch zu Hause. Das zeigt: Sprachförderung ist kein Luxus, sondern eine Grundvoraussetzung für Teilhabe.
DaZ ist kein einheitliches Programm. Es gibt drei große Säulen: Integrationskurse für Erwachsene, DaZ-Klassen in Schulen und zusätzliche Förderprogramme für Kinder. Jede Säule hat ihre eigenen Regeln, Finanzierungen und Probleme. Und sie sind nicht miteinander vernetzt - das ist einer der größten Fehler im System.
Integrationskurse: Pflicht, aber oft nicht ausreichend
Wer als Flüchtling oder Zuwanderer nach Deutschland kommt, bekommt oft einen Kursplatz für einen Integrationskurs. Das ist verpflichtend, und der Staat zahlt bis zu 800 Euro pro Person. Der Kurs besteht aus 600 Stunden Sprachunterricht und 100 Stunden Orientierung - also über 700 Stunden insgesamt. Der Zielwert ist B1, das heißt: Du kannst dich in Alltagssituationen verständigen, ein Gespräch führen, einen Brief schreiben.
Aber was bedeutet B1 in der Realität? Für einen Arzt aus Syrien, der 2023 einen Kurs absolvierte, war das nicht genug. Er brauchte weitere 200 Stunden Fachsprachkurse, um seine Approbation zu bekommen. Für eine ukrainische Mutter, die mit drei Kindern nach Deutschland kam, war der Kurs überfüllt - 25 Teilnehmer in einer Klasse, mit kaum individueller Unterstützung. Die Kurse sind oft zu allgemein. Sie lehren, wie man einen Bus nimmt oder einen Termin beim Amt vereinbart. Aber nicht, wie man einen Lebenslauf schreibt, wie man sich in einer deutschen Firma verhält oder wie man medizinische Fachbegriffe versteht.
2024 legten rund 320.000 Menschen den Deutsch-Test für Zuwanderer ab. Nur 56 Prozent erreichten B1. Drei von zehn lagen bei A2 - das ist das Niveau, bei dem man einfache Sätze bilden kann, aber kaum komplexe Gespräche führt. Und 11,6 Prozent schafften nicht einmal A2. Das sind Menschen, die nach einem Jahr Kurs immer noch kaum Deutsch sprechen. Die durchschnittliche Dauer bis B1 liegt bei 10,7 Monaten - aber für Sprecher asiatischer Sprachen wie Chinesisch oder Vietnamesisch dauert es fast zwei Monate länger als für Sprecher von Spanisch oder Italienisch. Warum? Weil die Sprachstrukturen so anders sind. Und das wird im Kurs kaum berücksichtigt.
DaZ-Klassen in der Schule: Chancen und Lücken
In der Schule ist die Situation anders. Hier gibt es DaZ-Klassen - spezielle Vorbereitungsklassen, in denen Kinder mit wenig oder keinem Deutsch erst einmal nur Deutsch lernen. Sie bekommen bis zu 25 Stunden pro Woche Sprachunterricht, bevor sie in die reguläre Klasse wechseln. Laut Bosch-Stiftung sprechen 48 Prozent der Kinder mit Migrationshintergrund zu Hause Deutsch und mindestens eine weitere Sprache. Das ist eine Ressource, die oft ignoriert wird.
Die gute Nachricht: Kinder, die DaZ-Unterricht bekommen, haben im Durchschnitt 11,3 Prozentpunkte bessere Deutschnoten als Kinder ohne Förderung. Das ist ein riesiger Unterschied. Die schlechte Nachricht: Die Qualität hängt vom Bundesland ab. In Bayern und Baden-Württemberg gibt es klare Lehrpläne, gut ausgebildete Lehrkräfte und klare Übergänge in die reguläre Klasse. In einigen ostdeutschen Bundesländern gibt es kaum Strukturen. Einige Schulen haben keine DaZ-Lehrkräfte - 38 Prozent der Schulen in ländlichen Gebieten beschäftigen keine speziell ausgebildeten Lehrer für DaZ.
Und dann ist da noch die Wartezeit. Kinder müssen oft wochenlang auf einen Platz in einer DaZ-Klasse warten. In Städten sind es durchschnittlich 4,2 Wochen. In ländlichen Regionen bis zu 14 Wochen. Das ist ein Jahr in der Lebenszeit eines Kindes. In dieser Zeit verpasst es nicht nur Sprachunterricht - es verpasst auch soziale Kontakte, Freundschaften, den Anschluss an die Klasse. Und je länger die Wartezeit, desto schwerer wird es später, aufzuholen.

Was funktioniert wirklich? Die Erfolgsmodelle
Nicht alles ist schlecht. Es gibt Programme, die wirklich helfen - und die zeigen, wie es besser gehen könnte.
Ein Beispiel ist „Startchancen“ vom Bundesbildungsministerium. Das Programm richtet sich an Grundschulkinder mit Migrationshintergrund. Es gibt zusätzliche Sprachförderung, kleine Gruppen, Elternarbeit und Materialien in mehreren Sprachen. Nach zwei Jahren berichteten 87 Prozent der teilnehmenden Schulen von deutlich besseren Deutschkenntnissen. Kein Wunder: Die Kinder lernen früh, in kleinen Gruppen, mit Bezug zum Alltag - und die Eltern werden eingebunden.
Ein weiterer Erfolg: Teilnehmer von Integrationskursen haben eine 23,4 Prozent höhere Beschäftigungsquote als Nicht-Teilnehmer mit gleichem Hintergrund. Das ist kein Zufall. Wer Deutsch spricht, bekommt einen Job. Und wer einen Job hat, fühlt sich eingebunden. Das ist Integration - nicht durch Gesetze, sondern durch Arbeit.
Und dann ist da die Digitalisierung. Seit 2023 bietet das BAMF Online-Kurse an. 37 Prozent der Teilnehmer nutzen sie. Das „Digitale DaZ-Lernportal“ hat über 1,2 Millionen Nutzerkonten. Jede Sitzung dauert durchschnittlich 47 Minuten - das ist viel. Die App ermöglicht es, Lerninhalte zu wiederholen, Übungen zu machen, wenn man Zeit hat - zwischen Arbeit, Kinderbetreuung, Arztterminen. Das ist Flexibilität. Und Flexibilität ist das, was viele traditionelle Kurse nicht bieten.
Warum das System scheitert: Defizitdenken statt Ressourcenorientierung
Ein großer Fehler im deutschen System ist das Defizitdenken. Es wird angenommen: Wer nicht Deutsch spricht, hat etwas verpasst. Wer nicht perfekt spricht, ist defizitär. Aber das ist falsch. Wer aus Syrien kommt, spricht vielleicht Arabisch, Englisch und ein bisschen Türkisch. Wer aus Vietnam kommt, spricht Vietnamesisch und hat vielleicht schon mal Englisch gelernt. Wer aus der Ukraine kommt, spricht Ukrainisch und Russisch - und versteht vielleicht schon mehr Deutsch, als man denkt.
Prof. Dr. Ingrid Gogolin von der Universität Hamburg sagt es klar: „Mehrsprachigkeit ist keine Lücke, sondern eine Ressource.“ Aber das System ignoriert das. Es fragt nicht: Was kann der Mensch schon? Es fragt nur: Was kann er noch nicht?
Das führt zu Frustration. Bei Erwachsenen. Bei Kindern. Bei Lehrern. Wer ständig nur seine Fehler hört, hört auf, zu lernen. Wer in einer Klasse mit 25 anderen sitzt und nie angesprochen wird, fühlt sich unsichtbar. Wer nach sechs Monaten immer noch nicht B1 hat, glaubt, er sei zu dumm - dabei ist das System schuld.
Prof. Dr. Anh Nga Longva von der Universität Bremen sagt: „Das DaZ-System muss lernen, die Sprachkompetenzen der Lernenden zu sehen - nicht nur ihre Lücken.“

Was kommt als Nächstes? Der Deutschpass und die Zukunft
Ab 2026 soll es einen „Deutschpass“ geben - ein einheitliches Sprachzertifikat, das alle bisherigen Nachweise ablöst. Das ist gut. Bisher gibt es zu viele verschiedene Tests: TestDaF, Goethe-Zertifikat, Deutsch-Test für Zuwanderer, Sprachnachweise für Schulen - alle unterschiedlich, alle schwer zu vergleichen. Ein Pass, der anerkannt ist - für Schule, Job, Behörden - das wäre ein großer Schritt.
Und die Regierung plant: Sprachkurse sollen schneller zum Job führen. Ziel ist es, die Zeit zwischen Kursbeginn und Berufseinstieg um 3,2 Monate zu verkürzen. Das bedeutet: Sprachförderung und Arbeitsmarkt werden enger verknüpft. Das ist notwendig. Denn wer Deutsch lernt, will arbeiten. Und wer arbeitet, lernt schneller - weil er es braucht.
Aber der Migrationsrat Deutschland warnt: „Die Strukturen reichen nicht, um die Bedürfnisse der wachsenden Zahl von Zuwanderern aus nicht-europäischen Ländern zu decken.“ Und das ist wahr. Die meisten neuen Zuwanderer kommen aus Ländern wie Syrien, Afghanistan, Somalia, Eritrea - wo die Sprachstrukturen von Deutsch weit entfernt sind. Und die Kurse sind noch immer auf Menschen aus Osteuropa oder der Türkei ausgelegt.
Was können Eltern, Lehrer, Nachbarn tun?
Du musst kein Experte sein, um zu helfen.
- Eltern: Sprich mit deinen Kindern in der Sprache, die du am besten kannst. Wenn du Arabisch sprichst, sprich Arabisch. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein. Und dann: Lerne gemeinsam Deutsch - mit Apps, mit Büchern, mit Kindersendungen. Ihr lernt beide.
- Lehrer: Frag nicht: „Warum spricht er kein Deutsch?“ Frag: „Was kann er schon?“ Nutze seine Sprachen als Brücke. Ein Kind, das Arabisch spricht, kann vielleicht Wörter in Deutsch mit Arabisch verknüpfen. Das ist Lernen mit Verständnis - nicht nur mit Auswendiglernen.
- Nachbarn, Kollegen, Freunde: Sprich mit Menschen, die Deutsch lernen. Nicht langsam, nicht laut, nicht wie mit einem Kind. Einfach normal. Sag: „Was hast du heute gemacht?“ - und warte auf die Antwort. Auch wenn sie fehlerhaft ist. Jede Unterhaltung zählt.
Integration passiert nicht in Klassenräumen. Sie passiert auf dem Spielplatz, im Supermarkt, im Arbeitszimmer. Sie passiert, wenn jemand sich verstanden fühlt - nicht nur sprachlich, sondern menschlich.
Die Zahlen sprechen - aber nicht für alle
76 Prozent der Eingewanderten sagen, sie sprechen gute oder sehr gute Deutschkenntnisse. Das ist ein großer Fortschritt. 2007 waren es nur 65 Prozent. Die Entwicklung ist positiv. Aber hinter jeder Zahl steckt eine Geschichte. Eine Mutter, die jeden Tag mit ihrem Kind Deutsch lernt. Ein junger Mann, der nach drei Jahren immer noch keinen Job findet, weil er „nur“ B1 hat. Ein Lehrer, der in einer Schule mit 80 Prozent DaZ-Schülern unterrichtet - und keine Unterstützung bekommt.
Deutsch als Zweitsprache ist kein Projekt. Es ist eine Lebensaufgabe. Und sie kann nur gelingen, wenn wir aufhören, sie als Pflicht zu sehen - und anfangen, sie als Chance zu sehen.
Was ist der Unterschied zwischen DaZ und Deutsch als Fremdsprache (DaF)?
DaZ steht für „Deutsch als Zweitsprache“ und bezieht sich auf Menschen, die in Deutschland leben und Deutsch als wichtigste Sprache für Alltag, Schule oder Arbeit lernen. DaF (Deutsch als Fremdsprache) hingegen ist für Menschen, die Deutsch in ihrem Heimatland lernen - zum Beispiel als Schulfach oder für eine Reise. DaZ ist integrationsorientiert, DaF ist oft akademisch oder reiseorientiert.
Wie lange dauert es, bis man B1 Deutsch spricht?
Im Durchschnitt dauert es 10,7 Monate, um B1 zu erreichen - aber das hängt stark von der Muttersprache ab. Sprecher romanischer Sprachen wie Spanisch oder Italienisch brauchen durchschnittlich 2,3 Monate weniger als Sprecher asiatischer Sprachen wie Chinesisch oder Vietnamesisch. Wer Vollzeit lernt, mit guter Unterstützung und motiviert ist, kann B1 auch in 6-8 Monaten erreichen. Wer nur abends Kurse besucht und wenig Praxis hat, braucht oft über ein Jahr.
Warum gibt es so viele unterschiedliche Sprachtests in Deutschland?
Bisher gab es keine einheitliche Regelung. Der Deutsch-Test für Zuwanderer gilt für Integrationskurse, das Goethe-Zertifikat wird oft von Universitäten verlangt, und für Schulen gibt es eigene Prüfungen. Das ist verwirrend. Deshalb wird ab 2026 der „Deutschpass“ eingeführt - ein einheitliches Zertifikat, das für Schule, Job und Behörden gilt. Das soll die Verwirrung beenden.
Können Erwachsene auch in DaZ-Klassen lernen?
Nein. DaZ-Klassen sind speziell für Kinder und Jugendliche in der Schule. Erwachsene lernen in Integrationskursen, die vom BAMF organisiert werden. Es gibt aber einige Sonderprogramme, wie z. B. „Deutsch für Mütter“ oder „Deutsch für Berufsanfänger“, die speziell auf Erwachsene zugeschnitten sind - aber das sind keine regulären DaZ-Klassen.
Wie kann ich als Lehrer mehr für DaZ-Schüler tun?
Beginne damit, die Sprachen deiner Schüler zu erkennen - nicht nur als „Problem“, sondern als Ressource. Nutze Bilder, Videos, Alltagsgegenstände. Lass sie in ihrer Muttersprache erzählen - dann übersetze gemeinsam. Arbeite mit kleinen Gruppen, nicht mit der ganzen Klasse. Und suche nach Unterstützung: Viele Schulen haben DaZ-Förderlehrkräfte - frag nach. Und: Gib ihnen Zeit. Sprachlernen braucht Geduld - nicht nur von den Schülern, sondern auch von den Lehrern.



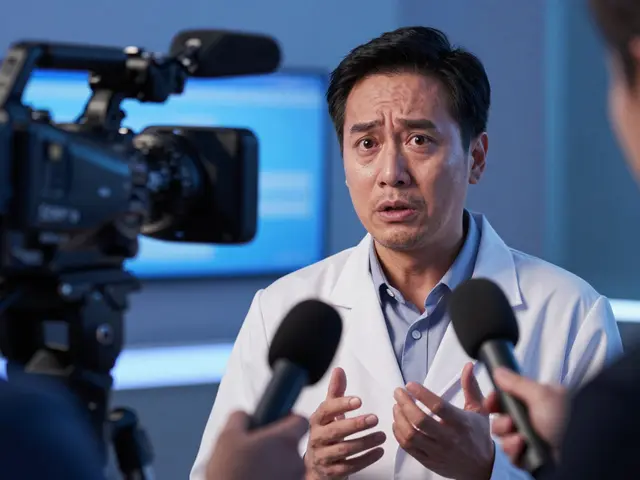



15 Kommentare
Oliver Sy
DaZ-System ist ein klassisches Beispiel für institutionalisiertes Defizitdenken. Die Ressourcenorientierung, die Gogolin fordert, wird systematisch ignoriert. Mehrsprachigkeit als kognitive Asset zu betrachten, wäre nicht nur pädagogisch klüger - es wäre ökonomisch sinnvoll. Wer Arabisch, Dari und Deutsch spricht, bringt Metakognition mit, die in der KI-Ära gefragter ist als reine B1-Kompetenz. Wir brauchen nicht mehr Kurse - wir brauchen eine Paradigmenverschiebung: von Sprachdefizit zu Mehrsprachigkeitspotenzial.
Steffen Ebbesen
Wieder so ein Text, der nur die Opferperspektive bedient. Wer nicht Deutsch lernt, hat ein Problem - nicht das System. 700 Stunden Kurs sind mehr als genug. Wer danach immer noch A2 hat, ist nicht motiviert. Kein Wunder, dass die Arbeitslosigkeit unter Migranten hoch ist - wenn man nicht mal die Sprache meistert, kann man nicht arbeiten. Das ist kein Systemversagen, das ist persönliche Verantwortung.
Stephan Brass
DaZ-Klassen? Ach ja, die mit den 25 Kindern und der Lehrerin, die 300x "Wo ist der Stift?" fragt. 😒 In meiner Stadt warten Kinder 10 Wochen - und dann wird ihnen beigebracht, wie man "Ich möchte ein Brot" sagt. Aber nicht, wie man einen Jobantrag schreibt. Wer baut das? Die Politik? Die Bildungsministerien? Die haben keine Ahnung. Einfach nur "B1" als Ziel zu setzen, ist lächerlich. Das ist wie beim Führerschein: Wer B1 hat, kann den Bus nehmen - aber nicht das Auto fahren.
Sven Schoop
Das ist alles nur politisch korrekte Wohlfühlpropaganda! Wer aus Syrien kommt, soll nicht erwarten, dass man ihm die Welt auf einem Silbertablett serviert. Wir haben unsere eigene Sprache, unsere eigene Kultur - und wer nicht mitkommt, bleibt draußen. 4,8 Millionen Menschen, die zu Hause kein Deutsch sprechen? Das ist kein Problem der Integration - das ist ein Problem der Überforderung. Warum nicht einfach sagen: Wer nicht Deutsch lernt, kriegt keine Sozialleistungen? Dann wären die Kurse plötzlich effektiv!
Markus Fritsche
Ich hab mal mit einem afghanischen Nachbarn geredet - er spricht Dari, Paschtu, ein bisschen Englisch, und lernt jetzt Deutsch mit einer App, während er seine Tochter zur Schule bringt. Er sagt: "Ich lerne nicht, weil ich muss. Ich lerne, weil ich verstehen will, wie hier alles funktioniert." Das ist der Schlüssel. Sprache ist nicht nur Vokabeln - sie ist Zugang. Und wenn wir sie als Zugang sehen, nicht als Mangel, dann wird sie lebendig. Kein Kurs der Welt ersetzt ein Gespräch im Supermarkt. 😊
Frank Wöckener
DaZ-Klassen sind eine Farce. Kinder werden isoliert, nicht integriert. Und dann wundern sich die Lehrer, warum die Kids nach zwei Jahren immer noch nicht mitreden können. Warum nicht einfach inklusiv unterrichten? Mit Sprachpaten, mit Bildern, mit Übersetzungs-Apps - und nicht mit 25-stündigen DaZ-Blödsinn, der nur dazu dient, die Lehrerstunden zu füllen. Und wer sagt, dass man B1 braucht, um einen Job zu kriegen? Ich kenne 3 Leute, die als Pflegehelfer arbeiten - und ihr Deutsch ist A2, aber sie verstehen die Patienten. Sprache ist nicht alles - Empathie schon.
Markus Steinsland
Die empirische Evidenz ist eindeutig: Sprachkompetenz korreliert mit Beschäftigungsquote, sozialer Teilhabe und Bildungserfolg. Doch die Implementierung bleibt fragmentiert. Die Säulen - Integrationskurse, DaZ-Klassen, digitale Lernplattformen - sind nicht interoperabel. Kein Data-Driven-Approach. Keine Einheitliche Lernhistorie. Kein Portfoliobasiertes Zertifizierungssystem. Der Deutschpass 2026 ist ein erster Schritt - aber ohne LMS-Integration und KI-gestützter Personalisierung bleibt es ein symbolischer Akt. Wir brauchen nicht mehr Kurse - wir brauchen ein Lernökosystem.
Rosemarie Felix
Die ganze Diskussion ist so müde. Wer glaubt, dass man in 10 Monaten B1 lernt, wenn man abends nach der Schicht noch drei Kinder betreut? Die Kurse sind für Leute, die keine Kinder haben, keine Arbeit und keine Zeit. Und dann wird noch behauptet, das System funktioniere - nur weil 76% sagen, sie sprechen "gutes" Deutsch? Wer hat die gefragt? Die, die 20 Jahre hier leben und immer noch Angst haben, beim Arzt zu sprechen? Lügen die nicht auch?!
Lea Harvey
Deutsch ist die Sprache unseres Landes. Wer nicht Deutsch lernt, hat kein Recht auf Sozialleistungen. Punkt. Warum sollen wir Steuern zahlen, damit jemand aus Afghanistan seine Muttersprache behält? Das ist keine Integration - das ist kulturelle Kolonialisierung. Wer hier lebt, spricht Deutsch. Punkt. Keine Ausreden. Keine Kurse. Keine DaZ-Klassen. Einfach Deutsch lernen - oder gehen.
Jade Robson
Ich arbeite in einer Grundschule mit 80% DaZ-Kinder. Jedes Kind hat eine Geschichte. Ein Junge aus Eritrea sagt mir jeden Morgen: "Ich lerne Deutsch, damit Mama versteht, was ich in der Schule mache." Kein Kurs, kein Test - das ist der Moment, in dem Sprache wirklich funktioniert. Es geht nicht um B1 oder A2. Es geht darum, dass jemand sich gesehen fühlt. Dass er weiß: Du bist hier. Du gehörst dazu. Das ist Integration. Und das kann kein Kurs leisten. Das kann nur ein Mensch tun - der bereit ist, zuzuhören.
Matthias Kaiblinger
Ich bin in Togo aufgewachsen, habe in Berlin studiert, und heute arbeite ich als Sprachtrainer für Flüchtlinge. Ich habe gesehen, wie Menschen mit 40 Jahren, die nie eine Schule besucht haben, nach 18 Monaten einen Job als Küchenhilfe bekommen - weil jemand ihnen jeden Tag 15 Minuten zugehört hat. Es geht nicht um den Lehrplan. Es geht nicht um die Anzahl der Stunden. Es geht um die menschliche Verbindung. Wenn du jemandem sagst: "Du kannst das", und du glaubst es auch, dann passiert Wunder. Nicht durch Kurse - durch Begegnung. Und das ist die wahre Integration: wenn jemand nicht nur Deutsch spricht, sondern sich zu Hause fühlt.
Kari Viitanen
Als Norwegerin, die in Deutschland lebt, finde ich es bemerkenswert, wie sehr das System auf Standardisierung setzt - während in Skandinavien die Individualisierung im Vordergrund steht. In Norwegen wird Mehrsprachigkeit als Ressource gesehen, nicht als Problem. Kinder mit Migrationshintergrund werden in reguläre Klassen integriert - mit gezieltem, aber nicht isolierendem Sprachunterricht. Der Fokus liegt auf Partizipation, nicht auf Perfektion. Vielleicht sollte Deutschland nicht mehr Kurse schaffen, sondern mehr Räume für natürliche Sprachentwicklung - im Alltag, im Verein, in der Nachbarschaft.
Quinten Peeters
Ich find’s komisch, dass alle über DaZ reden, aber keiner über die Lehrer spricht. Die sind überlastet, schlecht bezahlt, und bekommen keine Fortbildung. In meiner Stadt gibt’s eine Lehrerin, die 40 DaZ-Kinder in drei Klassen unterrichtet - und keine Assistentin. Wie soll das funktionieren? Die Politik redet von B1, aber die Schulen haben nicht mal Stifte. Wer hat die Kurse entwickelt? Leute, die noch nie in einer Klasse gestanden haben. Das ist wie ein Autohersteller, der nie gefahren ist - und dann behauptet, er wüsste, wie man fährt.
Jutta Besel
DaZ-Klassen sind ein kulturelles Versagen. Warum gibt es keine bilingualen Schulen? Warum wird nicht einfach mit Muttersprache und Deutsch parallel unterrichtet? Statt Kinder zu "fördern", sollte man sie als Mehrsprachige anerkennen. Und dann: Wer sagt, dass "B1" ausreicht? Ein Arzt braucht C1. Ein Lehrer braucht C1. Warum werden dann nicht die Kurse auf C1 ausgerichtet? Und warum gibt es keine Zertifizierung für Fachsprachen? Das ist doch lächerlich - wir haben einen Markt, der C1 verlangt, aber nur A2-B1 fördert. Wer ist schuld? Die Bildungspolitik. Und sie hat keine Ahnung.
Oliver Sy
Dein Punkt zur Lehrerunterstützung ist valid - aber die Lösung liegt nicht nur in mehr Personal, sondern in struktureller Vernetzung. Ein Lehrer in einer DaZ-Klasse sollte Zugang zu den Integrationskursen der Erwachsenen haben - um die Lernbiografien zu verstehen. Ein Kind, dessen Mutter gerade B1 macht, lernt anders als eines, dessen Eltern nur A1 sprechen. Wir brauchen ein zentrales Lernprofil, das über die Lebensphasen hinweg verfolgt wird. Das ist kein technisches Problem - das ist ein pädagogisches Paradigma.