Wie funktioniert die Elternberatung durch die Schulpsychologie in Österreich?
Wenn Sie als Elternteil Sorgen haben - ob wegen Lernschwierigkeiten, Verhaltensproblemen, Angst vor der Schule oder dem Übergang ins Schulsystem - dann ist die Schulpsychologie eine verlässliche Anlaufstelle. Sie ist kein Ersatz für eine Psychotherapie, aber ein wichtiger erster Schritt, um Probleme früh zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu finden. Die Beratung ist kostenlos, freiwillig und vertraulich. Sie brauchen keine Überweisung von einem Arzt oder der Schule, um einen Termin zu bekommen. Sie können direkt bei der Schulpsychologischen Beratungsstelle Ihrer Region anrufen oder eine E-Mail schreiben.
Der erste Kontakt meistens telefonisch oder per E-Mail. Dort klären Sie kurz ab, worum es geht. Die Schulpsychologin oder der Schulpsychologe fragt, wer betroffen ist - das Kind, die Lehrkraft, die Familie - und wie dringend es ist. Danach wird ein Termin vereinbart. Dieser kann in der Beratungsstelle, in der Schule, online oder auch telefonisch stattfinden. Bei Kindern unter 14 Jahren ist das schriftliche Einverständnis der Eltern nötig. Das ist gesetzlich so vorgesehen, um den Schutz des Kindes sicherzustellen.
Ein Beratungsgespräch dauert in der Regel eine Stunde. In den meisten Fällen sind es nicht mehr als fünf Sitzungen. Es geht nicht darum, das Kind zu „behandeln“, sondern das System Schule und Familie zu unterstützen. Die Schulpsychologin fragt: Was läuft gut? Wo hakt es? Wer ist beteiligt? Wie können wir gemeinsam etwas verändern?
Was wird in der Elternberatung besprochen?
Die Themen, die Eltern mit der Schulpsychologie besprechen, sind vielfältig. Oft geht es um den Schulstart. Viele Kinder sind am ersten Schultag überwältigt. Sie sagen nichts, weinen, verstecken sich. Das ist normal - aber Eltern wissen oft nicht, ob das noch in Ordnung ist oder ob sie handeln müssen. Die Schulpsychologie hilft dabei, diese Phase zu verstehen. Sie sagt: „Manchmal braucht ein Kind zwei Versuche, bis es sich traut, seine Fähigkeiten zu zeigen.“
Ein weiteres großes Thema sind Lernschwierigkeiten. Ein Kind rechnet nicht mit, liest langsam, vergisst Hausaufgaben. Ist das Faulheit? Oder steckt dahinter eine Lernstörung? Die Schulpsychologie prüft nicht, ob das Kind „intelligent“ ist, sondern wie es lernt. Sie schaut: Welche Strategien funktionieren? Wo fehlt Unterstützung? Wie kann die Schule anders vorgehen? Die Antwort ist oft nicht „das Kind braucht Förderung“, sondern „die Methode passt nicht“.
Verhaltensprobleme kommen häufig vor: aggressives Verhalten, Rückzug, ständige Streitigkeiten mit Mitschülern. Die Schulpsychologie fragt nicht „Warum ist das Kind so?“, sondern „Was löst dieses Verhalten aus?“. Vielleicht hat das Kind zu Hause viel Stress, fühlt sich in der Klasse nicht gehört oder hat Angst, versagt zu haben. Die Beratung hilft, diese Zusammenhänge sichtbar zu machen - und gemeinsam mit Schule und Familie neue Wege zu finden.
Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Inklusion. Eltern von Kindern mit Behinderung stellen oft Fragen wie: „Was bedeutet Sonderpädagogischer Förderbedarf?“, „Welche Rechte hat mein Kind?“, „Wie entscheidet man, nach welchem Lehrplan es unterrichtet wird?“. Die Schulpsychologie berät dabei, unterstützt bei Gesprächen mit der Schule und hilft, die richtigen Anträge zu stellen. Sie vermittelt auch Kontakte zu anderen Institutionen - zum Beispiel zu Frühförderstellen oder Ämtern.
Wie läuft ein Beratungsgespräch in der Schule ab?
Manchmal ist es sinnvoll, das Gespräch nicht nur mit den Eltern, sondern mit Lehrerin, Schulpsychologin und Kind gemeinsam zu führen. Das nennt man ein „Dreiecksgespräch“. Es hat einen klaren Vorteil: Alle Beteiligten sagen, was sie sehen und was sie brauchen. Die Lehrerin sagt: „Ich merke, dass Lukas sich immer zurückzieht, wenn wir in Gruppen arbeiten.“ Die Mutter sagt: „Zu Hause ist er ruhig, aber er sagt, er hat Angst, dass die anderen ihn auslachen.“ Das Kind sagt: „Ich will nicht, dass sie mich ansehen.“
Durch dieses gemeinsame Gespräch entsteht ein Bild, das keiner allein hätte sehen können. Die Schulpsychologin bringt das alles zusammen und sagt: „Es geht nicht darum, dass Lukas unsozial ist. Er hat Angst, in der Gruppe zu scheitern. Vielleicht braucht er eine kleine Aufgabe, bei der er sicher ist, dass er sie schafft.“
Die Vorbereitung ist entscheidend. Bevor Sie zum Gespräch gehen, überlegen Sie: Wer muss dabei sein? Was ist das wichtigste Problem? Was haben Sie schon versucht? Schreiben Sie sich drei Punkte auf. Das hilft, nicht abzuschweifen. Die Schulpsychologin wird nicht sagen: „Sie müssen jetzt alles ändern.“ Sie wird fragen: „Was wäre ein kleiner Schritt, den Sie nächste Woche versuchen könnten?“

Welche Rolle spielt die Schulpsychologie beim Schulstart?
Der Übergang vom Kindergarten in die Schule ist für viele Kinder eine große Herausforderung. Plötzlich gibt es feste Zeiten, viele Kinder, neue Regeln, eine fremde Lehrerin. Eltern spüren oft: „Mein Kind ist nicht bereit.“ Aber was heißt „bereit“? Die Schulpsychologie sagt: „Schulreife ist kein Alter, sondern eine Mischung aus emotionaler, sozialer und kognitiver Entwicklung.“
Wenn ein Kind bei der Anmeldung nicht sprechen will, sich versteckt oder weint, heißt das nicht, dass es nicht lernen kann. Es heißt nur: Es braucht mehr Zeit, um sich zu öffnen. Deshalb gibt es oft einen zweiten Termin - nicht als Prüfung, sondern als Chance. Beim zweiten Mal ist das Kind oft ruhiger, weil es weiß, was kommt. Die Schulpsychologin beobachtet: Kann das Kind aufmerksam sein? Kann es einfache Anweisungen folgen? Kann es mit anderen Kindern spielen? Nicht, um es zu bewerten, sondern um zu sehen, wo es Unterstützung braucht.
Eltern können vor dem Schulstart viel tun: Gemeinsam Bilderbücher anschauen, Geschichten erzählen, kleine Aufgaben geben - wie „Räume aufräumen“ oder „einen Einkaufszettel vorlesen“. Das baut Selbstvertrauen auf. Die Schulpsychologie gibt konkrete Tipps: „Reden Sie mit Ihrem Kind über die Schule, aber nicht nur als Pflicht. Fragen Sie: Was würdest du gerne in der Schule machen? Was ist dir wichtig?“
Was ist der Unterschied zwischen Schulpsychologie und Therapie?
Viele Eltern fragen: „Ist das eine Therapie?“ Nein. Die Schulpsychologie arbeitet nicht mit Diagnosen wie „ADHS“ oder „Angststörung“. Sie arbeitet mit dem Kontext: Schule, Familie, Klassengemeinschaft. Sie fragt: „Was kann die Schule anders machen?“, „Wie können wir das Zuhause unterstützen?“, „Welche Ressourcen hat das Kind?“
Wenn ein Kind eine tiefere psychische Belastung hat - etwa nach einem Trauma, bei schwerer Depression oder Essstörung - wird die Schulpsychologie Sie an eine Kinder- und Jugendpsychotherapeutin weiterleiten. Das ist kein Versagen. Das ist professionelles Handeln. Die Schulpsychologie kennt die Netzwerke. Sie weiß, wo es Hilfe gibt, wenn sie über ihre Grenzen hinausgeht.

Wo finde ich die Schulpsychologie in meiner Region?
Es gibt in jeder Bildungsregion Österreichs eine zuständige Schulpsychologische Beratungsstelle. In Wien, Graz, Salzburg, Linz, Innsbruck - überall. Sie finden die Kontaktdaten auf der Website Ihrer Bildungsdirektion. Suchen Sie einfach „Bildungsdirektion [Ihr Bundesland]“ und dann „Schulpsychologie“. Dort steht, wie Sie einen Termin bekommen, welche Öffnungszeiten es gibt und ob es auch Beratung in anderen Sprachen gibt.
Einige Regionen bieten auch regelmäßige Treffen für Eltern an - zum Beispiel zum Thema Inklusion. Dort können Sie andere Eltern kennenlernen, Erfahrungen austauschen und Fragen stellen, die Sie vielleicht nicht in der Schule stellen wollen. Manchmal gibt es sogar kostenlose Kinderbetreuung. Das ist besonders wichtig für Eltern, die sonst keinen Rückhalt haben.
Was passiert, wenn die Schule die Beratung empfiehlt?
Manchmal kommt die Einladung von der Schule: „Wir würden gern mit der Schulpsychologie sprechen.“ Das ist kein Vorwurf. Es ist ein Angebot. Die Lehrkraft merkt: „Das Kind braucht mehr als ich allein geben kann.“ Die Schulpsychologie wird dann nicht als „Prüfer“ kommen, sondern als Unterstützerin. Sie arbeitet mit der Schule zusammen - nicht gegen sie.
Wenn Sie sich unsicher sind: Fragen Sie. „Warum genau?“, „Was hat sich verändert?“, „Was haben Sie schon versucht?“. Sie haben das Recht, alles zu verstehen. Und Sie haben das Recht, den Termin abzusagen, wenn Sie noch nicht bereit sind. Die Schulpsychologie wartet. Sie kommt nicht mit Zwang. Sie kommt mit Respekt.
Wie kann ich als Elternteil die Beratung nutzen, ohne mich zu überfordern?
Es ist leicht, sich zu denken: „Ich bin schlechte Eltern, wenn ich Hilfe brauche.“ Das ist falsch. Gute Eltern fragen, wenn sie unsicher sind. Sie suchen Unterstützung, weil sie ihr Kind lieben. Die Schulpsychologie ist kein Zeichen von Versagen - sie ist ein Zeichen von Verantwortung.
Vermeiden Sie es, alle Probleme auf einmal zu klären. Konzentrieren Sie sich auf eines. „Ich möchte, dass mein Kind die Hausaufgaben macht, ohne dass wir streiten.“ Das ist ein klarer Fokus. Die Schulpsychologin wird dann nicht alles ändern. Sie wird einen kleinen Schritt vorschlagen: „Probiere eine feste Zeit, ohne Ablenkung. Nur zehn Minuten. Und dann loben, wenn es geklappt hat.“
Und vergessen Sie nicht: Sie sind der Experte für Ihr Kind. Die Schulpsychologin kennt die Theorie. Sie kennt die Praxis. Zusammen ergibt das die beste Lösung.


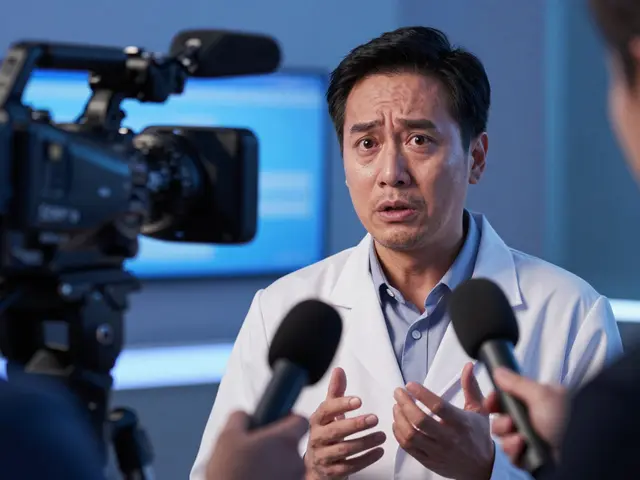




10 Kommentare
Ulrich Sander
Ich hab das letzte Jahr mit meinem Sohn durchgemacht 🥲 Die Schulpsychologin war wie ein Engel in Anzug – hat nicht nur geredet, sondern wirklich zugehört. Keine Diagnose, kein Druck, nur: „Was braucht dein Kind, damit er sich sicher fühlt?“ 🙏 Jetzt geht er freiwillig in die Schule. Das ist Magie.
Nick Ohlheiser
Ich war anfangs total skeptisch… aber nach dem ersten Gespräch? Ich hab geweint. Nicht weil es schlecht war, sondern weil endlich JEMAND verstand, dass es nicht um Faulheit geht, sondern um Angst, um Verlorenheit, um das Gefühl, nie gut genug zu sein… Danke, dass es diese Stellen gibt. 💔❤️
Lieve Leysen
In Belgien gibt’s so was auch, aber man muss erst durch 7 Behörden, bevor man einen Termin kriegt… Österreich macht’s richtig. Einfach anrufen, fertig. Und das mit den Dreiecksgesprächen? GENIAL. Endlich mal nicht nur die Lehrer oder die Eltern als Schuldige hinstellen. 🙌
Brecht Dekeyser
Leute ich hab neulich mit meiner Tochter ne Stunde lang über Schule geredet und sie hat mir gesagt: „Mama, ich hab Angst, dass die anderen denken ich bin doof.“ Ich hab nicht gewusst, was ich sagen soll… bis ich diesen Beitrag gelesen hab. Jetzt hab ich nen Termin. Danke fürs Schreiben. 🙏
Julia Wooster
Es ist doch lächerlich, dass man für eine elementare psychologische Unterstützung nicht erst eine ärztliche Überweisung braucht. Das ist ein Zeichen dafür, wie tief die Bildungssysteme in Mitteleuropa verrottet sind. Die Schulpsychologie ist kein Ersatz für eine echte Therapie – sie ist ein Band-Aid auf einer offenen Wunde.
Herbert Finkernagel
Und wer kontrolliert die Schulpsychologen? Wer zahlt sie? Wer entscheidet, was „normal“ ist? Ich hab schon Kinder gesehen, die wegen „Angst vor der Schule“ drei Monate zu Hause blieben – und dann wurde ihnen gesagt, sie wären „nicht schulfähig“. Das ist keine Beratung. Das ist sozialer Druck mit Psychologie-Label.
Timon Ostertun
Dreiecksgespräche sind überflüssig Kinder sollen lernen sich durchzusetzen nicht dass Erwachsene ständig ihre Hand halten. Schule ist kein Kinderladen
Markus Paul
Schulpsychologie. Ein moderner Ritual. Die Eltern brauchen Bestätigung, die Schule braucht Deckung, das Kind wird zum Objekt. Ich habe es erlebt. Es verändert nichts. Es verleiht nur den Anschein von Handeln.
Stefanie Barigand
Das ist ja jetzt der Wahnsinn! Wir haben in Deutschland seit Jahren den Anspruch, dass Kinder früh in die Schule kommen, und dann klagen wir, weil sie nicht „bereit“ sind? Und jetzt soll noch eine Psychologin die Schule retten? Nein. Die Eltern müssen erziehen. Nicht die Schule. Nicht die Psychologen. Die Eltern. Punkt.
Ulrich Sander
Ich find’s lustig, dass jemand sagt, das sei nur ein Band-Aid… aber wenn dein Kind jeden Morgen weint, weil es in die Schule muss – was willst du dann? Eine Diagnose? Eine Medikation? Oder einfach jemanden, der fragt: „Was brauchst du, damit du dich sicher fühlst?“ Das ist kein Band-Aid. Das ist Menschlichkeit.