Was ist interdisziplinäre Forschung - und warum ist sie in Österreich wichtig?
Stell dir vor, du willst verstehen, warum Menschen in einer Stadt immer seltener Bewegung machen. Ein Arzt könnte sagen: Es liegt an der Gesundheit. Ein Stadtplaner: Die Gehwege sind schlecht. Ein Informatiker: Die Fitness-Apps funktionieren nicht. Ein Soziologe: Die Menschen fühlen sich unsicher. Keiner von ihnen hat unrecht - aber nur gemeinsam können sie die ganze Wahrheit sehen. Das ist interdisziplinäre Forschung: Wenn Disziplinen, die sonst in getrennten Welten arbeiten, zusammenkommen, um komplexe Probleme zu lösen.
In Österreich ist das keine neue Idee, aber eine, die sich gerade stark verändert. Seit 2023 gibt es einen klaren Trend: Die Bundesregierung investiert mehr Geld, Universitäten bauen neue Zentren auf, und Forschende aus Medizin, Technik, Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften arbeiten enger zusammen als je zuvor. Doch es gibt auch Hürden - administrative Labyrinthe, unterschiedliche Sprachen zwischen den Fächern, und Karrierewege, die noch immer für Einzelkämpfer ausgelegt sind.
Die großen Zentren: Wo interdisziplinäre Forschung in Österreich lebt
Österreich hat keine einzige große Einrichtung, die alles abdeckt. Stattdessen gibt es eine Vielzahl von spezialisierten Zentren, die wie kleine Brennpunkte wirken. Sie sind oft klein, aber sehr fokussiert - und deshalb effektiv.
Das Comprehensive Cancer Center (CCC) an der Medizinischen Universität Wien ist ein Paradebeispiel. Hier arbeiten Onkologen, Molekularbiologen, Pflegekräfte, Ethiker und Datenwissenschaftler unter einem Dach. Sie verbinden Grundlagenforschung mit klinischer Praxis - kein Patient wird nur von einem Arzt behandelt, sondern von einem Team, das alle Facetten der Krankheit kennt. Seit 2023 läuft das CCC als offizieller Cluster innerhalb der Uni, mit klaren Strukturen und eigenem Budget. Das ist selten. Die meisten interdisziplinären Projekte in Österreich sind nur temporär finanziert - das CCC ist fest verankert.
In Innsbruck läuft das Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung (CGI) seit 20 Jahren. Es ist kein Institut für Frauenforschung im klassischen Sinn, sondern ein Netzwerk mit über 100 Mitgliedern aus Philosophie, Recht, Psychologie, Soziologie, Medizin und Kunst. Sie untersuchen, wie Geschlecht in allen Bereichen der Gesellschaft wirkt - von der Medizintechnik bis zur Rechtsprechung. 2023 startete CGI eine Kooperation mit dem Interdisziplinären Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Gesellschaft (IFZ), um zu erforschen, warum Frauen in der KI-Entwicklung immer noch unterrepräsentiert sind. Die Antwort wird nicht nur in der Psychologie liegen, sondern auch in der Ingenieurskultur, den Einstellungsprozessen und den Finanzierungsmodellen.
Am Interdisziplinären Zentrum für Mittelalter und Frühneuzeit (IZMF) an der Universität Salzburg arbeiten Historiker, Sprachwissenschaftler, Archäologen, Kunstgeschichtler und Literaturwissenschaftler zusammen. Sie nutzen digitale Methoden, um Handschriften zu analysieren, und vergleichen die soziale Struktur von Dörfern im 15. Jahrhundert mit den Überlieferungen in kirchlichen Akten. Hier wird nicht nur Geschichte gemacht - sie wird neu interpretiert, weil die Disziplinen sich nicht mehr gegenseitig ignorieren.
Digital Health and Care: Wo Technik und Pflege sich treffen
Eines der dynamischsten Zentren ist das Forschungszentrum Digital Health and Care an der Hochschule Campus Wien. Es ist kein klassisches Uni-Institut, sondern eine Kooperation zwischen Pflegewissenschaft, Informatik, Physiotherapie und Sozialarbeit. Hier entstehen keine theoretischen Modelle - sondern konkrete Tools, die im Alltag genutzt werden.
Ein Projekt aus 2022: Eine App, die Patienten nach einer Operation mit Echtzeit-Feedback beim Training unterstützt. Techniker entwickelten die Software, Pflegekräfte testeten sie mit 42 Patienten, und Sozialarbeiter sorgten dafür, dass auch Menschen ohne Smartphone die Funktion nutzen konnten. Ergebnis: Die Therapietreue stieg um 32%. Kein Forscher hätte das allein geschafft. Es brauchte die Kombination.
Leiter Franz Werner spricht von einer „Drehscheibenfunktion“: Das Zentrum verbindet Expertise aus unterschiedlichen Bereichen, macht sie sichtbar und bringt sie in die Lehre. Studierende lernen hier nicht nur Theorie - sie arbeiten in Teams mit Pflegekräften, Ingenieuren und Patienten. Das ist Bildung der Zukunft.

Finanzierung und Struktur: Warum viele Projekte scheitern
Die gute Nachricht: Die Fördermittel für interdisziplinäre Forschung in Österreich sind in den letzten acht Jahren fast verdoppelt worden. Der Anteil am Gesamtfördervolumen des Wissenschaftsfonds FWF stieg von 12,3% (2015) auf 24,7% (2022). Die Bundesregierung hat 2023 ein neues Strategiepapier verabschiedet - mit 50 Millionen Euro bis 2026 für neue Zentren.
Doch die schlechte Nachricht: Die meisten Projekte sterben, bevor sie richtig anfangen. Warum? Weil sie nicht institutionalisiert sind. Ein Projekt, das nur drei Jahre läuft, kann keine langfristigen Beziehungen aufbauen. Ein Forscher, der in zwei Disziplinen publiziert, bekommt oft keine Beförderung, weil die Bewertungskriterien noch immer disziplinär sind.
Die größten Hürden, wie eine Umfrage des Österreichischen Wissenschaftsrats 2022 zeigte, sind:
- 68%: Unterschiedliche Fachbegriffe - ein Biologe versteht „Modell“ anders als ein Soziologe
- 57%: Unterschiedliche Erwartungen - ein Ingenieur will messbare Ergebnisse, ein Historiker will Interpretationen
- 49%: Komplexe Finanzierungswege - Anträge müssen oft bei mehreren Stellen eingereicht werden
Lösungen gibt es: Die TU Wien bietet seit 2021 ein „Interdisziplinäres Projektstart-Programm“ an, das Teams bei der gemeinsamen Sprache, der Governance und der Antragstellung unterstützt. Die Universität Wien hat ein Förderprogramm mit bis zu 150.000 Euro pro Jahr für interdisziplinäre Netzwerke. Und das Zentrum für evidenzbasierte Versorgungsforschung in Krems ist eine Kooperation zwischen Uni und Landesgesundheitsfonds - eine seltene Form der Finanzierung, die langfristig stabil ist.
Was Studierende sagen: Zufriedenheit und Herausforderungen
Wer in einem interdisziplinären Programm studiert, ist oft sehr zufrieden - aber auch oft überfordert.
Der Masterstudiengang „Gender, Kultur und Sozialer Wandel“ an der Universität Innsbruck hat 2022 eine Zufriedenheitsrate von 87% (n=124). Studierende schätzen besonders, dass sie „Querverbindungen zwischen Disziplinen herstellen“ können - ein Begriff, der auch auf der Plattform UniRating für das IZMF in Salzburg mit 4,2 von 5 Sternen gelobt wird.
Aber es gibt auch Kritik. Auf Forschungsforen wie ResearchGate beschweren sich Doktoranden über „administrative Hürden“ und „unterschiedliche Publikationskulturen“. Ein Physiker, der in einem medizinischen Projekt mitarbeitet, muss oft zwei Artikel schreiben - einen für Physik-Journals, einen für Medizin-Journals. Beide haben andere Anforderungen. Wer das macht, braucht doppelte Zeit - und bekommt dafür oft keine Anerkennung in seiner eigenen Disziplin.
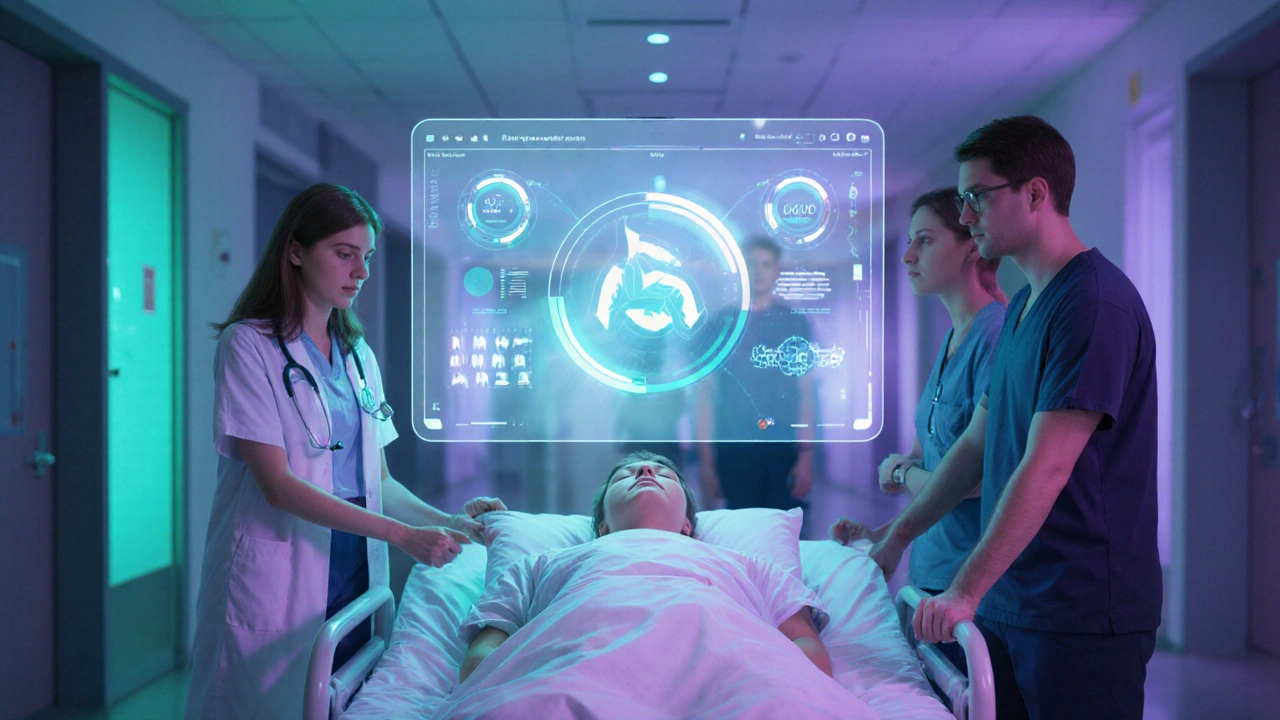
Die Zukunft: Was kommt als Nächstes?
Die Medizinische Universität Wien plant bis Herbst 2024 einen neuen Forschungscluster für digitale Gesundheit - mit Informatikern, Medizinern und Sozialwissenschaftlern. Das ist ein klares Signal: Die Zukunft liegt nicht mehr in der Einzeldisziplin, sondern in der Verknüpfung.
Das CGI in Innsbruck und das IFZ in Wien arbeiten gemeinsam an „Gender in der Technikentwicklung“. Die TU Wien baut ihre Forschungskoordination zur zentralen Anlaufstelle aus. Und die Bundesregierung hat endlich erkannt: Interdisziplinäre Forschung ist kein Randthema - sie ist notwendig für die Bewältigung von Klimawandel, Gesundheitskrise und Digitalisierung.
Doch der entscheidende Punkt bleibt: Solange Habilitationen und Beförderungen nach disziplinären Kriterien bewertet werden, werden viele Talente aus der interdisziplinären Forschung abwandern. Die Strukturen müssen sich ändern - nicht nur die Projekte.
Interdisziplinäre Forschung in Österreich ist kein Trend. Sie ist eine Notwendigkeit. Und sie hat schon jetzt Erfolge. Aber sie braucht mehr als Geld - sie braucht Mut, neue Regeln und Menschen, die bereit sind, über den Tellerrand zu schauen.
Was du als Forschender oder Studierender tun kannst
- Suche nach Zentren, die schon funktionieren - wie das CCC, das CGI oder das Forschungszentrum Digital Health and Care - und frag nach Praktika oder Mitarbeit
- Verwende die Angebote der Universitäten: TU Wien, Uni Wien und FH Campus Wien bieten Schulungen zur interdisziplinären Projektarbeit an
- Wenn du ein Projekt startest: Beginne mit einem klaren gemeinsamen Problem - nicht mit einer Methode
- Vermeide jargonreiche Sprache. Erkläre deine Disziplin so, als würdest du sie jemandem erzählen, der nichts davon weiß
- Frage nach institutioneller Verankerung: Wird dein Projekt nach drei Jahren einfach verschwinden? Oder ist es Teil eines dauerhaften Zentrums?



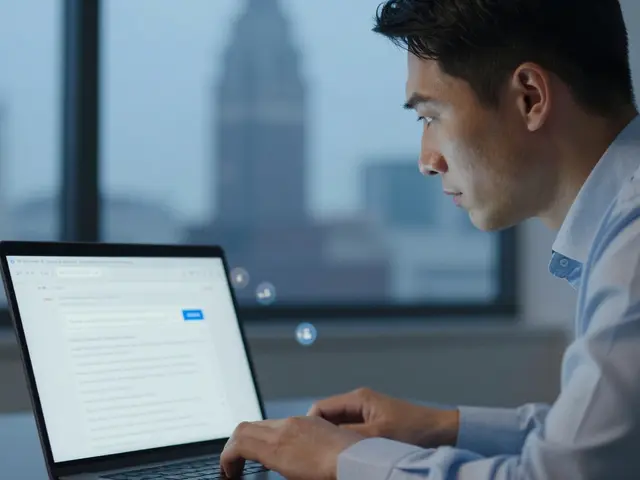

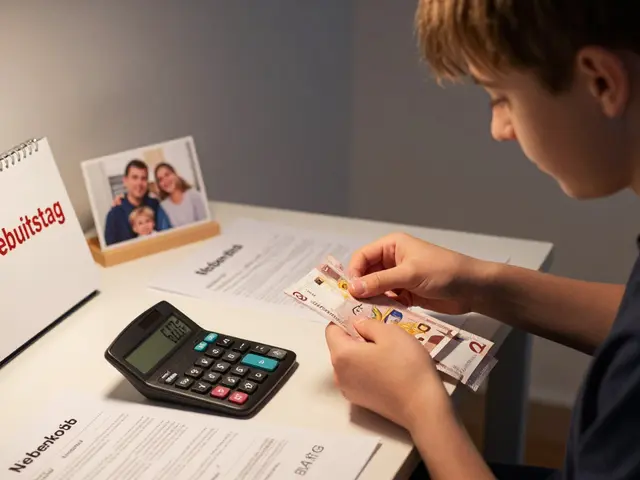
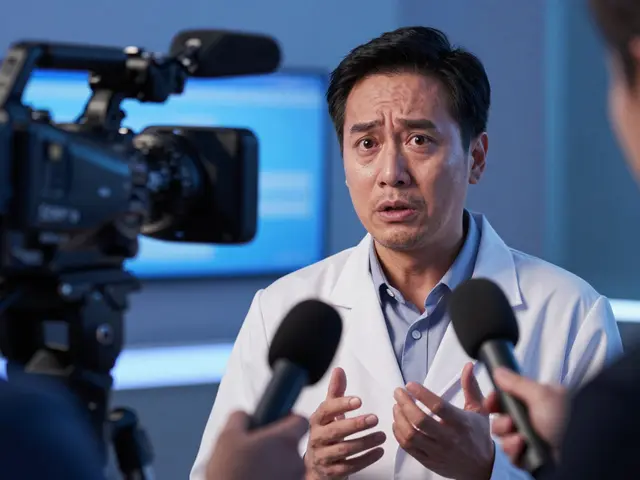
11 Kommentare
Nga Hoang
Das ist alles schön und gut, aber wer zahlt das? Wir haben doch genug Leute, die sich nur mit dem eigenen Fach beschäftigen, und jetzt sollen wir noch mehr Geld für Leute ausgeben, die nicht mal ihre eigene Sprache beherrschen? Biologen reden von 'Modellen', Soziologen von 'Narrativen' – das ist kein Forschungskonzept, das ist ein Bürokratiemärchen.
Kyle Kraemer
Ich hab das mal mitgekriegt, als ich bei einer Uni-Veranstaltung war. Die Leute saßen da und redeten aneinander vorbei. Irgendwie klingt das alles sehr nach PR-Text, aber ich hab noch nie jemanden gesehen, der wirklich was damit gemacht hat. Einfach zu viel Gerede, zu wenig Ergebnis.
Susanne Lübcke
Was ist eigentlich Wahrheit, wenn sie aus mehreren Disziplinen zusammengesetzt wird? Ist sie dann wahrer? Oder nur komplizierter? Ich denke oft, wir verwechselen Interdisziplinarität mit Verwirrung. Aber vielleicht ist das ja genau der Punkt – dass wir aufhören, alles in Schubladen zu stecken. Die Welt ist kein Labor, sondern ein Fluss. Und wir versuchen, ihn mit Linealen zu messen.
karla S.G
Ich find’s krass, wie viele Leute hier von 'Zentren' schwärmen, aber vergessen, dass Österreich doch eigentlich ein kleines Land ist. Wir brauchen keine 17 neuen Forschungscluster, wir brauchen weniger Bürokratie und mehr echte Wissenschaft – nicht dieses Getue mit 'Gender in der KI-Entwicklung'. Wer hat das überhaupt bezahlt? Und warum ist das nicht in der Zeitung? Weil’s nur ein paar Insider interessiert.
Stefan Lohr
Die Zitate aus der Umfrage des Österreichischen Wissenschaftsrats 2022 sind korrekt wiedergegeben. Die Prozentzahlen stimmen, die Struktur der Hürden ist logisch aufgebaut. Allerdings fehlt die Quellenangabe für die Aussage über die 50 Millionen Euro bis 2026. Das Strategiepapier wurde am 14. März 2023 verabschiedet, nicht im Januar. Korrekturen sind notwendig.
Elin Lim
Interdisziplinarität ist kein Ziel. Es ist ein Symptom. Wir haben versagt, als wir die Wissenschaft in Fachgebiete zerschlagen haben. Jetzt versuchen wir, die Bruchstücke wieder zu kleben. Aber Klebstoff reicht nicht. Wir brauchen neue Fundamente.
INGEBORG RIEDMAIER
Die institutionelle Verankerung interdisziplinärer Forschungsprojekte stellt eine zentrale Voraussetzung für nachhaltige Wirkung dar. Die bisherigen Fördermodelle, die auf projektbasierte, zeitlich begrenzte Finanzierungsströme setzen, erzeugen strukturelle Instabilität und verhindern die Ausbildung von langfristigen Kooperationsnetzwerken. Es ist dringend erforderlich, dass die Hochschulgesetze entsprechend reformiert werden, um interdisziplinäre Karrierewege formal zu legitimieren und akademische Anerkennungssysteme zu adaptieren.
Koen Punt
Interdisziplinarität ist der letzte Schrei der akademischen Selbsttäuschung. Sie ist die Wissenschaft für Leute, die nicht gut genug in ihrem Fach sind, um allein zu bestehen. Die CCC-Struktur? Ein PR-Gebäude mit teuren IT-Tools und einem Haufen Doktoranden, die sich gegenseitig zitieren. Und jetzt wollen sie das noch in die Lehre einbauen? Die Studierenden werden nur verwirrt. Die echte Forschung passiert in den Laboren – nicht in Workshops mit Pflegekräften und Philosophen.
Harry Hausverstand
Ich hab mal mit einem Physiker und einer Pflegerin zusammen an so ner App gearbeitet. Keiner hat sich verstanden. Aber am Ende hat sie funktioniert. Die Leute haben gesagt: Endlich jemand, der nicht nur redet. Ich sag immer: Es geht nicht darum, dass alle dieselbe Sprache sprechen. Es geht darum, dass sie sich einfach mal zuhören. Ohne Protokoll. Ohne Antrag. Nur Mensch zu Mensch.
Rosemarie Felix
Die ganze Diskussion ist lächerlich. Wer will denn diese interdisziplinären Projekte? Nur die, die in ihrem eigenen Fach nicht weiterkommen. Und jetzt soll das noch als Zukunft gelten? Wir brauchen Experten, keine Allzweckwunder. Und wer sagt, dass ein Soziologe was über Technik versteht? Hauptsache, sie kriegen Fördergelder. Das ist keine Forschung, das ist ein Sozialprojekt mit Uni-Logo.
Lea Harvey
Die Zukunft liegt nicht in der Verknüpfung, sondern in der Reinheit der Disziplinen. Wer sich nicht auf eine Sache konzentriert, wird nie etwas Großes erreichen. Diese ganzen Zentren sind nur ein Ablenkungsmanöver, damit die Politik vorgibt, etwas zu tun. Aber die echten Probleme bleiben ungelöst. Und wer das nicht sieht, der ist blind.