Was bedeutet es wirklich, wenn ein Lehrplan nicht mehr sagt, was gelernt werden soll, sondern wie Schülerinnen und Schüler damit umgehen können? Seit Anfang der 2000er-Jahre hat sich die Logik hinter deutschen Schulcurricula grundlegend verändert. Es geht nicht mehr nur darum, dass die Klasse den Stoff aus dem Buch durchgenommen hat. Es geht darum, ob sie ihn nutzen können - in einer anderen Situation, mit einem anderen Problem, unter anderem Druck. Dieser Wandel heißt kompetenzorientierter Unterricht.
Was ist Kompetenzorientierung wirklich?
Vielleicht hast du schon mal erlebt, wie ein Schüler ein Gedicht auswendig kann, aber nicht erklären kann, warum es traurig klingt. Oder wie jemand alle Formeln für Physik kennt, aber nicht weiß, wie er sie auf ein echtes Problem anwendet. Das ist der alte Ansatz: Wissen als Inhaltsliste. Kompetenzorientierung sagt: Wissen allein reicht nicht. Es muss beweglich sein. Es muss sich anpassen. Es muss helfen, etwas zu lösen.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat 2003/2004 die ersten bundesweiten Bildungsstandards eingeführt - und damit den Grundstein gelegt. Seitdem wird nicht mehr gefragt: „Haben wir die Kapitel 3 bis 7 durchgenommen?“ Sondern: „Können die Schülerinnen und Schüler jetzt eine komplexe Aufgabe bearbeiten?“
Die offizielle Definition lautet: Kompetenzen sind die Fähigkeiten, die jemand hat - oder erlernen kann -, um Probleme zu lösen. Dazu gehören nicht nur Wissen und Können, sondern auch die Motivation, sich einzusetzen, mit anderen zusammenzuarbeiten und sich in neuen Situationen zurechtzufinden. Das ist kein abstrakter Begriff. Das ist der Unterschied zwischen jemandem, der eine Rechnung lösen kann, und jemandem, der weiß, wann er sie braucht, wie er sie überprüft und was er tut, wenn das Ergebnis nicht passt.
Wie sieht ein kompetenzorientierter Unterricht aus?
Ein klassischer Deutschunterricht früher: Der Lehrer erklärt die Merkmale des Realismus, die Schüler notieren, schreiben eine Zusammenfassung, machen eine Klausur. Heute: Die Klasse bekommt eine Aufgabe - etwa: „Ein Jugendlicher aus der Gegenwart liest einen Text von Theodor Storm. Wie würde er ihn verstehen? Was würde ihn verwirren? Was würde ihn berühren?“
Das ist kein Zufall. Diese Aufgabe ist bewusst komplex. Sie verlangt nicht nur Wissen über Literatur, sondern auch historisches Verständnis, empathisches Denken, Sprachfähigkeit und die Fähigkeit, eigene Gedanken strukturiert darzustellen. Und sie hat kein einziges „richtiges“ Ergebnis. Es gibt mehrere valide Antworten - je nachdem, wie die Schülerinnen und Schüler denken, recherchieren, diskutieren.
Das ist der Kern: Lernaufgaben müssen herausfordernd sein, kooperatives Arbeiten ermöglichen, ein konkretes Produkt verlangen (ein Poster, ein Video, ein Gespräch, ein Text) und unterschiedliche Wege zulassen. Ein Schüler mag lieber schreiben, ein anderer lieber sprechen. Beide können kompetent sein - aber auf unterschiedliche Weise.
Und das ist auch der Grund, warum Lehrpläne heute nicht mehr als Inhaltskataloge geschrieben werden, sondern als Kompetenzraster. In Bayern mit dem LehrplanPLUS oder in Nordrhein-Westfalen mit dem Lehrplan 2019 steht nicht mehr „Thema: Industrialisierung“ - sondern „Die Schülerinnen und Schüler können die Auswirkungen der Industrialisierung auf Lebensweisen und Umwelt analysieren und bewerten.“
Die sieben Stufen der Kompetenzentwicklung
Es gibt keine Einbahnstraße von „nicht wissen“ zu „kann es“. Kompetenzen wachsen schrittweise. In Sachsen wurde das in sieben klare Ebenen gegliedert - und diese Struktur wird heute in vielen Bundesländern als Orientierung genutzt:
- Einblick gewinnen: Ich höre zum ersten Mal davon.
- Kennen: Ich weiß, was das ist.
- Übertragen: Ich kann es in einer ähnlichen Situation anwenden.
- Beherrschen: Ich kann es sicher und fehlerfrei tun.
- Anwenden: Ich nutze es in einer neuen, ungewohnten Situation.
- Beurteilen / sich positionieren: Ich kann bewerten, was gut oder schlecht ist - und meine eigene Meinung begründen.
- Gestalten / Problemlösen: Ich entwickle etwas Neues - ich löse ein echtes Problem, das keine vorgefertigte Lösung hat.
Diese Stufen zeigen: Kompetenz ist kein Endzustand. Sie ist ein Prozess. Und sie braucht Zeit. Ein Schüler, der heute noch nur „kennt“, braucht nicht gleich „gestalten“ zu können. Aber er muss wissen, wohin er sich entwickeln soll.
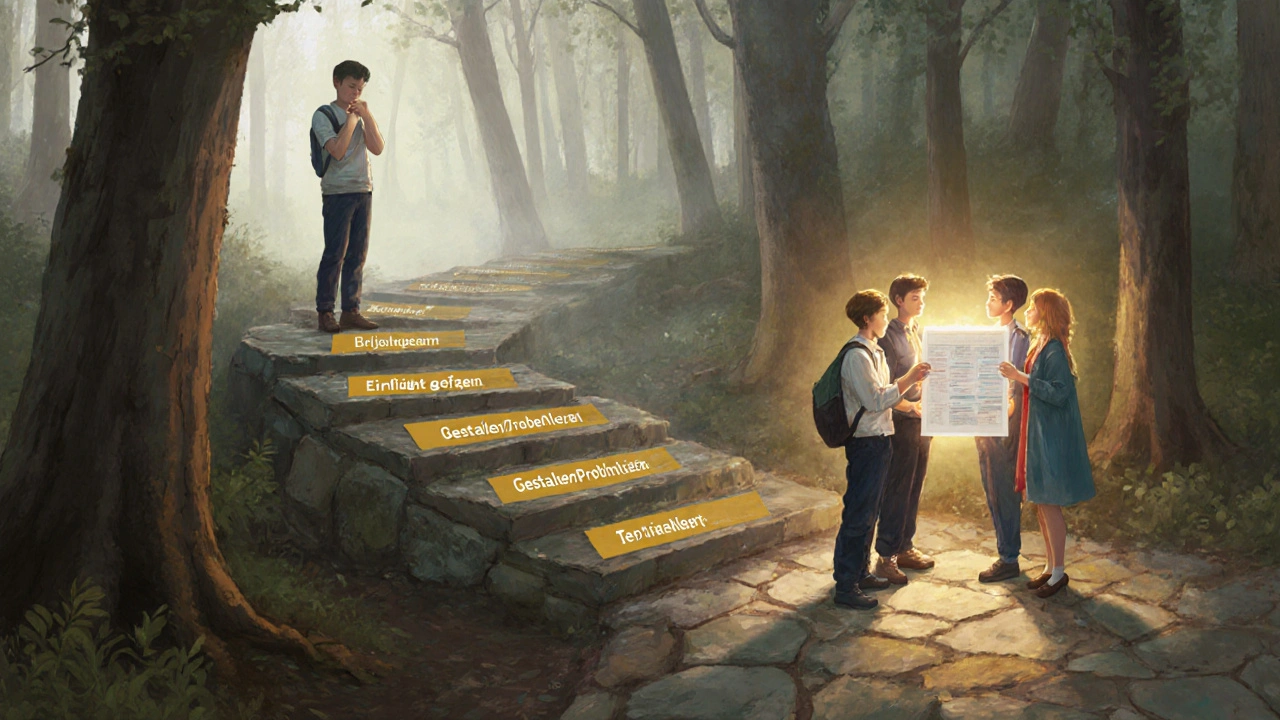
Was Lehrer wirklich brauchen - und was oft schiefgeht
Die meisten Lehrkräfte wollen kompetenzorientiert unterrichten. Aber viele fühlen sich überfordert. Warum? Weil sie oft denken: „Kompetenzorientierung = mehr Methoden.“ Also wechseln sie alle fünf Minuten zwischen Gruppenarbeit, Präsentation, Rollenspiel, Online-Recherche - und vergessen dabei das Wesentliche: Der Inhalt muss immer zum Ziel führen.
Dr. Anke Wischgoll sagt es klar: „Es geht nicht darum, die Methode zu wechseln. Es geht darum, die Methode so zu wählen, dass sie die Kompetenz fördert.“
Ein Beispiel: Wenn du den Schülern ein Video über Klimawandel zeigen willst, dann ist das nicht automatisch kompetenzorientiert. Erst wenn sie danach selbst eine Forschungsfrage formulieren, Quellen bewerten, ein Argument aufbauen und ihre Position schriftlich begründen - erst dann ist es Kompetenzentwicklung.
Und dann ist da noch die Balance. Zu viel Struktur? Dann wird’s zur Routine. Zu wenig Struktur? Dann verlieren Schülerinnen und Schüler sich. Der Schlüssel liegt in der klaren Aufgabenstellung - und in der Bereitschaft, unterschiedliche Wege zuzulassen. Ein Schüler braucht vielleicht eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ein anderer braucht nur einen Anstoß. Beide können am Ende das gleiche erreichen.
Die Rolle der Digitalisierung und der eigenen Lernverantwortung
Die Pandemie hat gezeigt: Schülerinnen und Schüler, die lernen konnten, ohne ständig angeleitet zu werden, haben besser durchgehalten. Das ist kein Zufall. Kompetenzorientierung baut auf Selbstständigkeit auf. Wer weiß, wie er recherchiert, wie er Fehler analysiert, wie er sich Wissen aneignet - der ist unabhängiger.
Der Digitalpakt Schule hat das nicht erfunden - aber er hat es beschleunigt. Digitale Tools ermöglichen es heute, Lernprozesse sichtbar zu machen: Wer hat welche Quellen genutzt? Wie hat er sich verbessert? Welche Rückmeldungen hat er bekommen? Plattformen wie Lernmanagementsysteme oder digitale Portfolios helfen dabei, den Lernweg zu dokumentieren - nicht nur das Endprodukt.
Und das ist der nächste Schritt: Diagnose. Es reicht nicht mehr, am Ende eine Note zu geben. Lehrkräfte brauchen Werkzeuge, um zu sehen, wo genau ein Schüler steht - in welcher Kompetenzstufe er sich bewegt. Projekte wie „Bildung in der Krise“ an der Universität Bremen arbeiten daran, genau solche Instrumente zu entwickeln - nicht als Test, sondern als Gesprächsgrundlage.

Kritik: Ist Bildung nur noch Kompetenz?
Nicht jeder ist begeistert. Der Bildungsforscher Jürgen Oelkers warnt: „Kompetenzorientierung darf nicht zum Selbstzweck werden.“ Was, wenn wir nur noch messen, was messbar ist? Was, wenn wir vergessen, dass Bildung auch um Schönheit, um Sinn, um das Staunen geht? Dass manche Dinge nicht „kompetenzorientiert“ vermittelt werden können - weil sie nicht funktionieren, sondern einfach da sein müssen?
Kurt Reusser aus Zürich sagt: „Kompetenzorientierung ist kein Ersatz für Bildung - sie ist ihr Rahmen.“ Es geht nicht darum, alles zu reduzieren. Es geht darum, das Wissen so zu verankern, dass es lebendig bleibt. Dass ein Schüler nicht nur weiß, was ein Gedicht ist - sondern dass es ihn berührt. Dass er es nicht nur analysiert - sondern es mit anderen teilt. Dass er es versteht - und trotzdem fragt: Warum?
Was bleibt - und wohin geht es?
Die PISA-Studie 2022 zeigt erste positive Signale: Deutsche Schülerinnen und Schüler werden besser darin, komplexe Probleme zu lösen - besonders wenn es um Transfer geht. Das ist der Erfolg der letzten 20 Jahre.
Die Zukunft liegt in drei Bereichen:
- Digitalisierung als Teil der Kompetenz: Nicht nur „mit dem Computer umgehen“, sondern Daten bewerten, Algorithmen verstehen, digitale Identitäten reflektieren.
- Sozial-emotionale Kompetenzen: Wie lerne ich, wenn ich frustriert bin? Wie rede ich mit jemandem, der eine andere Meinung hat? Das ist kein Nebenfach - das ist zentral.
- Individuelle Lernwege: Kein Schüler lernt gleich. Der Unterricht der Zukunft wird nicht mehr alle gleichzeitig auf das gleiche Ziel führen - sondern unterschiedliche Pfade ermöglichen, die alle zum gleichen Ziel führen: Selbstständiges, kritisches, lebenslanges Lernen.
Es geht nicht darum, alte Methoden abzuschaffen. Es geht darum, sie neu zu denken. Der Lehrplan ist kein Buch, das man durchliest. Er ist ein Werkzeug - und die Schülerinnen und Schüler sind die Nutzer. Ihre Kompetenzen sind das Ziel. Nicht der Stoff. Nicht die Note. Nicht die Methode. Sondern: Können sie es? Und werden sie es weiterentwickeln?







12 Kommentare
Lutz Herzog
Das ist ja mal wieder typisch deutsche Bildungspolitik: Alles kompetenzorientiert, aber keiner sagt, was eigentlich gelernt werden soll. Ich hab meine Tochter letzte Woche beim Mathe-Test beobachtet – die hat 20 Seiten über ‘Problemlösungsstrategien’ geschrieben, aber nicht mal die Grundrechenarten drauf. Werden die Kids jetzt im Job auch ‘Kompetenzen’ vorlegen müssen statt konkreter Fähigkeiten? Ich sag nur: Kein Wunder, dass unsere Industrie abwandert.
Silje Løkstad
OMG this is sooo relevant!! 🤯 Kompetenzorientierung isn't just pedagogy – it's a systemic paradigm shift! The KMK standards are basically the first step toward a competency-based learning economy where cognitive flexibility > rote memorization. But let’s be real: most teachers are still stuck in the 90s with their ‘Thema: Industrialisierung’ slides. We need micro-credentialing, AI-driven diagnostic dashboards, and scaffolded competency matrices ASAP. #FutureOfEd
Nga Hoang
Wieder so ein blöder EU-Import! In meiner Zeit war Bildung was anderes – man lernte, was man brauchte. Heute machen die Kinder ‘Gedichte verstehen’ und können nicht mal mehr einen Brief schreiben. Und jetzt soll man auch noch ‘sozial-emotionale Kompetenzen’ messen? Das ist kein Unterricht, das ist Sozialarbeit mit Schuluniform. Wir brauchen wieder Disziplin, nicht ‘kompetente’ Kinder, die nicht mal die Zahlen richtig schreiben können.
Kyle Kraemer
Ich hab das alles gelesen. Warum muss das so lang sein? Ich will nur wissen: Macht das jetzt den Unterricht besser oder nur komplizierter? Und wer bezahlt die ganzen neuen Schulungen für die Lehrer? Ich bin schon froh, wenn mein Sohn seine Hausaufgaben macht. Kompetenzen? Ich glaub, die meisten Lehrer verstehen das selbst nicht.
Susanne Lübcke
es ist als ob wir die schule zu einer werkstatt für lebensfähigkeit umbauen – aber vergessen haben, dass kinder auch einfach mal in stille verliebt sein dürfen. was ist mit dem zauber des unerklärlichen? dem gedicht, das dich trifft, ohne dass du es analysieren musst? ich hab als kind ein gedicht auswendig gelernt – und es hat mich jahre lang begleitet. ohne kompetenzraster. ohne bewertung. einfach so. warum muss alles messbar sein? manchmal ist das unmessbare das wertvollste.
karla S.G
Ich hab das jetzt 3x gelesen und muss sagen: Wer das hier verfasst hat, hat echt keine Ahnung vom echten Schulalltag. Ich hab 15 Jahre unterrichtet – und die meisten Schüler können heute nicht mal mehr einen Satz richtig schreiben. Kompetenz? Ja, klar – aber erst, wenn sie die Grundlagen beherrschen! Wer sagt, dass ein Schüler ‘kompetent’ ist, wenn er nicht mal die Rechtschreibung kann? Das ist doch nur eine Ausrede, um den Unterricht zu verwässern. Und jetzt kommt auch noch Digitalpakt – ohne dass wir mal die Grundlagen gefestigt haben. Ich bin enttäuscht.
Stefan Lohr
Die sieben Stufen sind gut strukturiert – aber die Formulierung in den Lehrplänen ist oft ungenau. Was heißt ‘analysieren und bewerten’? Wer definiert das? Wer überprüft, ob das überhaupt messbar ist? Und warum wird nie gesagt, wie viele Stunden dafür nötig sind? Lehrer werden mit diesen Vorgaben überfordert, weil sie keine klaren Handlungsempfehlungen haben. Das ist kein Leitfaden – das ist ein juristisches Durcheinander mit pädagogischem Aufdruck.
Elin Lim
Bildung ist kein Produkt. Kompetenz ist kein Ziel. Es geht um den Menschen. Nicht um die Methode. Nicht um die Note. Um das Sein.
INGEBORG RIEDMAIER
Die Implementierung kompetenzorientierter Lehrpläne erfordert eine strukturierte, systematische und evidenzbasierte Reform der Lehrkräfteausbildung, der curricularen Ausrichtung sowie der diagnostischen Praxis im Unterricht. Es ist unerlässlich, dass die Kultusministerien nicht nur Rahmenrichtlinien erlassen, sondern auch die notwendigen Ressourcen, Fortbildungsinfrastrukturen und qualitätssichernde Evaluationssysteme bereitstellen, um eine kohärente und nachhaltige Transformation des Bildungssystems zu gewährleisten. Die empirischen Daten der PISA-Studien belegen die Notwendigkeit dieser Transformation.
Koen Punt
Interessant, dass niemand erwähnt, dass diese Kompetenzmodelle aus der anglo-amerikanischen Bildungstheorie stammen – und völlig unvermittelt in ein europäisches, traditionelles Bildungssystem gepresst werden. Wo bleibt die kulturelle Kontextualisierung? Wer hat diese Standards überhaupt geprüft? Wer hat die deutschen Schüler*innen als Subjekte in diesen Prozess einbezogen? Oder ist das wieder nur ein technokratisches Projekt von Bildungsökonomen, die nie einen Klassenraum betreten haben?
Harry Hausverstand
Ich hab das mit meiner Tochter ausprobiert – sie ist 12. Wir haben ‘Industrialisierung’ nicht als Thema gelernt, sondern als Aufgabe: ‘Wie würde dein Opa das erlebt haben?’ Sie hat mit Opa geredet, Fotos gesucht, ein kleines Video gemacht. Hat geweint, als er erzählt hat, wie er mit 10 in der Fabrik war. Ich hab nie gedacht, dass sie so was versteht. Aber sie versteht es. Und das zählt mehr als jede Note.
Stephan Lepage
habt ihr mal ne schule besucht? die lehrer sind überlastet die schüler sind verwirrt und die eltern wissen nicht mehr was sie tun sollen. kompetenz? ja super aber erstmal lass uns die kinder lesen und schreiben lehren bevor wir sie zu philosophen machen. ich hab nen sohn der kann 1000 wörter schreiben aber nicht mal eine rechnung machen. das ist doch krank. und jetzt soll man noch ‘sozial-emotionale kompetenzen’ messen? wtf. ich will nur dass mein kind die grundlagen kann. mehr nicht.