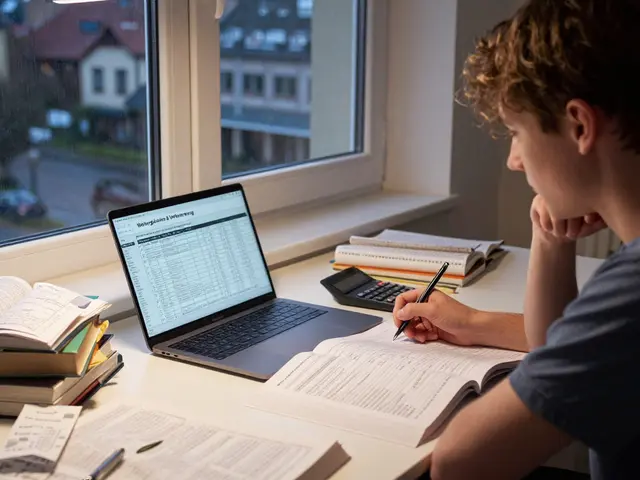Was ist ein Nachhaltigkeitsbericht an einer österreichischen Schule?
Ein Nachhaltigkeitsbericht ist keine bloße Pflichtübung. Es ist das dokumentierte Ergebnis davon, wie eine Schule mit ihren Schüler:innen, Lehrer:innen und der Gemeinschaft über Monate oder Jahre daran arbeitet, die Welt ein Stückchen besser zu machen. In Österreich ist das kein freiwilliges Extra mehr - es ist Teil des Bildungsauftrags. Seit Jahren verpflichtet das Bundesministerium für Bildung alle Schulen, sich mit den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) auseinanderzusetzen. Das bedeutet: Es geht nicht nur um Mülltrennung oder Energiesparen. Es geht um Gerechtigkeit, Bildung für alle, faire Arbeitsbedingungen, Klimaschutz, Artenvielfalt und Demokratie - alles zusammen.
Wie entsteht so ein Bericht? Der Prozess hinter den Zahlen
Ein guter Nachhaltigkeitsbericht beginnt nicht mit einem leeren Dokument, sondern mit einer Frage: Was passiert eigentlich in unserer Schule, und wie können wir es besser machen? Schüler:innen messen den Stromverbrauch im Gebäude, zählen, wie viele Kinder mit dem Fahrrad kommen, fragen nach, wie oft die Cafeteria Plastikverpackungen verwendet, oder organisieren eine Schulversammlung, in der über fair gehandelte Schokolade diskutiert wird. Diese Beobachtungen werden gesammelt, analysiert und in konkrete Projekte umgesetzt. Ein Beispiel: Eine 6. Klasse in Graz hat festgestellt, dass die Heizung in der Turnhalle oft unnötig läuft. Sie haben einen Plan erstellt, einen Antrag an die Schulleitung gerichtet - und jetzt wird die Heizung nur noch vor dem Unterricht eingeschaltet. Das ist kein Theorieprojekt. Das ist echte Veränderung.
Der Bericht selbst dokumentiert diesen Prozess: Was haben wir beobachtet? Was haben wir getan? Was hat funktioniert? Was nicht? Und was kommt als Nächstes? Es ist ein lebendiges Werkzeug, kein starrer Formulartext. Die meisten Schulen nutzen dafür die Materialien des Umwelt-Bildungs-Zentrums Steiermark (UBZ), die für jede der 17 SDGs konkrete Unterrichtsideen, Hintergrundinfos und Arbeitsblätter bereitstellen. Die Berichte werden meist von einer Lehrkraft koordiniert, aber sie dürfen nicht nur von Erwachsenen geschrieben werden. Die besten Berichte entstehen, wenn Kinder und Jugendliche aktiv mitbestimmen - und das ist auch der größte Lerneffekt.
Die wichtigsten Inhalte: Was muss drinstehen?
Es gibt keine einheitliche Vorlage, aber es gibt klare Erwartungen. Ein guter Nachhaltigkeitsbericht enthält mindestens diese Elemente:
- Projektbeschreibungen: Konkrete Aktionen, die in den letzten 12 Monaten stattgefunden haben - vom Schulgarten über eine Klimawoche bis hin zu einem Schüler:innen-Parlament.
- Daten und Messungen: Zahlen, die zeigen, ob sich etwas verändert hat. Zum Beispiel: „Der Stromverbrauch sank um 18 % nach dem Austausch der Lichter.“
- Beteiligung: Wer war beteiligt? Schüler:innen, Eltern, die Gemeinde, lokale Vereine? Wie wurde eingebunden?
- Reflexion: Was hat gut funktioniert? Was war schwierig? Was haben wir gelernt?
- Ausblick: Was kommt als Nächstes? Welche Ziele haben wir für das nächste Jahr?
Wichtig ist: Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, transparent zu sein. Eine Schule, die nur ein Projekt erfolgreich umgesetzt hat, aber ehrlich darüber berichtet, hat einen besseren Bericht als eine, die fünf Projekte aufzählt, aber keine Ergebnisse zeigt.

Warum macht das überhaupt Sinn? Der Nutzen für Schule und Schüler:innen
Manche Lehrer:innen denken: „Noch ein Bericht - wir haben doch schon genug Papierkram.“ Aber die Realität sieht anders aus. Schulen, die regelmäßig Nachhaltigkeitsberichte erstellen, erleben eine Veränderung im ganzen Haus. Die Kommunikation zwischen Lehrer:innen, Schülern und Eltern verbessert sich. Die Schule wird sichtbar als Ort, an dem handlungsfähige Menschen lernen. Eltern kommen auf die Schule zu, weil sie sehen, dass hier etwas Ernstes passiert. Schüler:innen entwickeln ein Gefühl der Eigenverantwortung. Sie lernen nicht nur über Nachhaltigkeit - sie lernen, wie man etwas verändert.
Die Volksschule Wölfnitz in Klagenfurt ist ein Paradebeispiel. Dort diskutieren Kinder seit Jahren über Schulentwicklung - sie entscheiden mit, wie die Pausen gestaltet werden, wie Geld für Projekte ausgegeben wird, ob die Schule Bio-Milch kaufen soll. Die Ergebnisse? Kinder, die besser kommunizieren, kritischer denken und sich weniger als passive Zuschauer, sondern als aktive Mitglieder der Gemeinschaft fühlen. Das ist Bildung für die Zukunft - und das ist der wahre Nutzen.
Die großen Netzwerke in Österreich: ÖKOLOG, Klimaschulen und mehr
Österreich hat keine einzige Regel, sondern ein ganzes Netzwerk von Unterstützungsprogrammen. Das bekannteste ist ÖKOLOG, das seit 1995 besteht und heute 800 Schulen umfasst. Es bietet Schulen einen klaren Rahmen, Fortbildungen, Materialien und regionale Berater:innen, die bei der Erstellung helfen. Fast 80 % der Schulen nutzen diese Unterstützung - und 92 % sagen, sie sei „sehr wertvoll“.
Daneben gibt es das Klimaschulen-Programm, das sich besonders auf Klimaschutz und Energieeinsparung konzentriert. Über 200 Schulen sind dabei. Und dann gibt es noch „Umweltzeichen Schulen“, „Schule der Zukunft“ oder „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ - insgesamt über 20 Initiativen. Viele Schulen machen gleich mehrere mit, weil sie sich ergänzen. Einige Schulen nutzen das ÖKOLOG-Programm als Rahmen, fügen aber Klimaschulen-Projekte hinzu oder arbeiten mit dem Umwelt-Bildungs-Zentrum zusammen.
Das ist ein Vorteil: Man kann wählen, was passt. Aber auch ein Nachteil: Wer nicht weiß, wo er anfangen soll, gerät leicht in eine Überforderung. Hier helfen die Regionalteams von ÖKOLOG - sie beraten Schulen, helfen bei der Auswahl der richtigen Programme und verhindern, dass man sich im Labyrinth der Zertifikate verliert.
Die Herausforderungen: Zeit, Aufwand und die Gefahr der Berichtsflut
Es ist kein Geheimnis: Ein guter Nachhaltigkeitsbericht braucht Zeit. Laut Studien brauchen Schulen im Durchschnitt 60 bis 80 Stunden pro Jahr - größere Schulen mit mehr als 500 Schüler:innen bis zu 120 Stunden. Das ist viel. Und es ist kein Mal pro Jahr. Es ist eine kontinuierliche Arbeit: Projekte planen, durchführen, dokumentieren, reflektieren.
Die größte Hürde? Die Zeit. Lehrer:innen haben schon genug zu tun. Wenn Nachhaltigkeit nur als zusätzliches Projekt gesehen wird, bleibt sie auf der Strecke. Die besten Schulen integrieren sie in den Alltag: Ein Projekt in Biologie, ein Beitrag in Sozialkunde, eine Präsentation in Deutsch - das macht es nachhaltig. Digitalisierung hilft: Seit 2022 gibt es eine offizielle Plattform des BMB, auf der Schulen ihre Berichte online erstellen und austauschen können. Das spart Papier und macht die Arbeit leichter.
Aber es gibt auch eine größere Gefahr: Die „Berichtsflut“. Wenn es nur noch darum geht, einen Bericht abzuliefern, ohne dass echte Veränderung stattfindet, dann ist der pädagogische Wert verloren. Prof. Dr. Herbert Ucsnik warnt davor: „Wenn wir nur noch zählen, wie viele Berichte abgegeben wurden, statt zu schauen, was wirklich gelernt wurde, dann haben wir versagt.“ Qualität zählt - nicht Quantität.

Die Zukunft: Digital, vernetzt und immer wichtiger
Die Entwicklung geht klar in eine Richtung: Nachhaltigkeitsberichte werden Teil der Schulentwicklung. Sie werden nicht mehr nur als Dokumentation, sondern als Instrument für Qualitätsverbesserung genutzt. In einigen Bundesländern werden sie bereits in die Schulinspektion einbezogen. Bis 2025 prognostizieren Experten, dass über 90 % der österreichischen Schulen einen strukturierten Bericht haben werden - das ist ein enormer Sprung.
Was wird sich ändern? Die Digitalisierung wird weiter voranschreiten. Schulen werden ihre Daten in Echtzeit erfassen - Energieverbrauch, Mobilität, Abfallmengen - und über digitale Dashboards sichtbar machen. Internationale Schulpartnerschaften werden häufiger, wo Schüler:innen aus Österreich mit Kindern aus anderen Ländern gemeinsam an SDG-Projekten arbeiten. Und die Schüler:innen selbst werden immer mehr zur treibenden Kraft - nicht nur als Mitwirkende, sondern als Projektleiter:innen.
Der Schlüssel bleibt: Es geht nicht um den perfekten Bericht. Es geht darum, dass Kinder lernen, dass sie etwas bewegen können. Und dass Schulen zeigen, dass Bildung nicht nur im Lehrplan steht - sondern im täglichen Handeln.
Was macht einen guten Nachhaltigkeitsbericht aus?
Ein guter Bericht ist:
- Authentisch: Er zeigt echte Projekte - nicht nur schöne Fotos.
- Beteiligt: Schüler:innen sind aktiv dabei, nicht nur Zuschauer.
- Reflektiert: Er sagt nicht nur „Wir haben es gemacht“, sondern „Was haben wir gelernt?“
- Konkret: Mit Zahlen, Daten, Ergebnissen - nicht nur mit Absichtserklärungen.
- Verknüpft: Er zeigt, wie Nachhaltigkeit in den Unterricht passt - nicht als Extrawurst.
Ein schlechter Bericht ist:
- Ein Formular, das nur ausgefüllt wurde, weil es verpflichtend ist.
- Ein Sammelsurium aus Einzelaktionen ohne Zusammenhang.
- Ein Dokument, das nur von der Schulleitung geschrieben wird - ohne Schüler:innen.
- Ein Bericht, der nie wieder gelesen wird - nach der Abgabe.
Wie startet man als Schule?
Wenn du als Lehrkraft oder Schulleitung mit einem Nachhaltigkeitsbericht beginnen willst: Fang klein an.
- Wähle ein Thema, das euch bewegt - Energie, Mobilität, Ernährung, Müll, Demokratie.
- Frage die Schüler:innen: Was findet ihr wichtig? Was würdet ihr gerne ändern?
- Erhebt Daten: Zählt, misst, beobachtet - nicht nur spekuliert.
- Entwickelt eine kleine Aktion - z. B. „Kein Plastik in der Pause“ oder „Fahrradtag einmal pro Woche“.
- Dokumentiert es - mit Fotos, Texten, Interviews.
- Teilt es mit der Schule - in der Aula, auf der Website, im Elternbrief.
Das ist der Anfang. Und es ist genug. Du brauchst nicht alles auf einmal. Du brauchst nur den Mut, anzufangen - und die Bereitschaft, zuzuhören.
Muss jede Schule in Österreich einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen?
Ja, seit der Einführung der UN-Nachhaltigkeitsziele im österreichischen Bildungssystem ist die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts verpflichtend. Alle Schulen - von der Volksschule bis zum Gymnasium - sind aufgefordert, regelmäßig über ihre Aktivitäten zur Bildung für nachhaltige Entwicklung zu berichten. Es gibt keine Ausnahmen, aber es gibt unterschiedliche Wege: Jede Schule kann selbst entscheiden, wie sie das umsetzt - ob über ÖKOLOG, Klimaschulen oder ein eigenes Konzept.
Wie viel Zeit braucht eine Schule für einen Nachhaltigkeitsbericht?
Im Durchschnitt brauchen Schulen zwischen 60 und 80 Stunden pro Jahr. Kleinere Schulen mit weniger als 200 Schüler:innen kommen oft mit 50-60 Stunden aus, während größere Schulen mit über 500 Schüler:innen bis zu 120 Stunden investieren. Der Aufwand hängt davon ab, wie intensiv die Projekte sind und ob externe Unterstützung genutzt wird. Die meisten Schulen verteilen die Arbeit über das ganze Jahr - kein großer Aufwand einmal im Jahr, sondern kleine Schritte regelmäßig.
Welche Rolle spielen Schüler:innen bei der Erstellung?
Die besten Berichte entstehen, wenn Schüler:innen aktiv mitgestalten - nicht nur als Probanden, sondern als Entscheider:innen. Sie sammeln Daten, führen Interviews, entwickeln Projekte und präsentieren Ergebnisse. Die Volksschule Wölfnitz in Klagenfurt zeigt, wie Schüler:innen in einem eigenen Parlament über Schulentwicklung abstimmen. Das stärkt nicht nur den Bericht - es stärkt Demokratiekompetenz. Lehrkräfte sind dabei die Begleiter:innen, nicht die alleinigen Verfasser:innen.
Gibt es Hilfsmittel oder Vorlagen für Schulen?
Ja, das Umwelt-Bildungs-Zentrum Steiermark (UBZ) bietet kostenlose Unterrichtsmappen für alle 17 SDGs - mit Hintergrundinformationen, Unterrichtsideen und Arbeitsblättern für alle Schulstufen. Das Bundesministerium für Bildung stellt eine digitale Plattform zur Verfügung, auf der Schulen ihre Berichte online erstellen und austauschen können. Außerdem unterstützen die ÖKOLOG-Regionalteams Schulen mit Beratung, Workshops und Materialien - kostenlos und auf Anfrage.
Warum gibt es so viele verschiedene Programme in Österreich?
Österreich hat keine einheitliche Lösung, sondern ein vielfältiges Netzwerk. Das liegt an der langen Tradition der Umweltbildung und an der Stärke der regionalen Akteure. Während in anderen Ländern nur ein Programm vorherrscht, gibt es hier über 20 Initiativen - von ÖKOLOG über Klimaschulen bis zu lokalen Umweltzeichen. Das ist ein Vorteil: Schulen können wählen, was zu ihnen passt. Aber es ist auch eine Herausforderung: Wer nicht weiß, wo er anfangen soll, kann leicht überfordert sein. Die ÖKOLOG-Regionalteams helfen dabei, den Überblick zu behalten.
Kann ein Nachhaltigkeitsbericht auch zur Schulentwicklung beitragen?
Absolut. Ein guter Bericht ist kein Ende, sondern ein Anfang. Er zeigt, wo die Schule steht, wo sie hinwill und wie sie dorthin kommt. Viele Schulen nutzen ihn als Grundlage für ihren Schulentwicklungsplan. Er hilft, Ressourcen gezielt einzusetzen, Lehrkräfte zu vernetzen und die Schulkultur zu verändern. Die besten Schulen sehen den Bericht nicht als Pflicht, sondern als Werkzeug für mehr Partizipation, Transparenz und Qualität.