Im Jahr 2025 ist Citizen Science in Österreich kein Nischenphänomen mehr - es ist ein fest verankertes Element der wissenschaftlichen Landschaft. Tausende Kinder, Jugendliche, Familien und Erwachsene sammeln Daten, beobachten Tiere, messen Luft- oder Wasserqualität und tragen damit direkt zur Forschung bei. Und für diese Beteiligung gibt es nicht nur Dank - es gibt auch Preise. Der Citizen Science Award ist der zentrale Wettbewerb, der seit 2015 systematisch die partizipative Wissenschaft in Österreich fördert. Er ist kein abstrakter Preis für Forscher:innen in Laboren, sondern eine konkrete Anerkennung für Menschen, die draußen in der Natur, im Klassenzimmer oder vor der Haustür Wissenschaft mitgestalten.
Wie funktioniert der Citizen Science Award?
Der Award läuft jedes Jahr nach einem klaren Zeitplan. Von September bis Anfang November können Forschungseinrichtungen, Schulen oder Vereine ihre Projekte für das nächste Jahr anmelden. Wer dabei ist, bekommt dann im Frühjahr Zugang zu einer Plattform, wo Schüler:innen, Jugendgruppen oder Familien sich für die Mitforschung anmelden können. Die aktive Phase läuft von April bis Juli - das ist die Zeit, in der die Teilnehmer:innen tatsächlich Daten sammeln. Ob sie Frösche aufspüren, Blütenblätter zählen oder den Himmel nach Sternen absuchen: Jede Beobachtung zählt. Im Herbst folgt dann die Preisverleihung, bei der die besten Projekte ausgezeichnet werden.Was macht diesen Award besonders? Er richtet sich nicht nur an Profis. Er will genau die Menschen erreichen, die sonst selten in der Wissenschaft zu finden sind: Kinder, Lehrer:innen, Großeltern, Jugendliche, Familien. Die Projekte sind deshalb so gestaltet, dass sie mit einfachen Mitteln funktionieren - ein Smartphone, ein Notizbuch, ein Fernglas. Die wissenschaftliche Qualität wird durch Expert:innen gesichert, die die Daten prüfen und interpretieren.
Was gewinnt man? Geld, Sachpreise und Anerkennung
Die Preisstruktur ist bewusst unterschiedlich, je nachdem, wer mitmacht. Für Schulklassen und Jugendgruppen gibt es Geldpreise: 1.000 Euro für den ersten Platz, 750 Euro für den zweiten und 500 Euro für den dritten. Diese Summen sind nicht riesig, aber sie sind sinnvoll eingesetzt - oft für neue Messgeräte, Ausflüge zu Forschungsinstituten oder Materialien für das nächste Projekt.Einzelpersonen und Familien bekommen keine Geldpreise, sondern Sachpreise. Und die sind oft überraschend konkret: Jahreskarten für den Tiergarten Schönbrunn, T-Shirts mit Reptilienmotiven von der Österreichischen Gesellschaft für Herpetologie, oder Unterstützung von der BOKU oder dem Naturschutzbund. Diese Preise sind kein Werbegeschenk - sie sind eine Einladung, weiterzumachen. Wer einen Preis für das Amphibienprojekt gewinnt, bekommt vielleicht eine Einladung zum Forschungslabor, wo er oder sie sehen kann, wie die eigenen Daten in eine wissenschaftliche Studie einfließen.
Welche Projekte wurden ausgezeichnet?
Ein Beispiel: Das Projekt „AmphiBiom - Amphibien erlauschen und Arten schützen!“ hat eine App entwickelt, mit der Kinder und Erwachsene die Rufe von Fröschen und Kröten aufnehmen und an eine zentrale Datenbank senden. Im Jahr 2024 haben 850 Nutzer:innen über 12.500 Meldungen gesammelt. Die Schulen, die dabei besonders gut mitgemacht haben, wurden mit Preisen ausgezeichnet. Kein theoretischer Sieg - sondern ein echter Erfolg, der zur Artenschutzforschung beiträgt.In Niederösterreich wurden 15 Schulen und zwei Kinderbetreuungseinrichtungen für ihre Arbeit zur Wasserqualitätsmessung geehrt. In Salzburg haben Jugendliche mit Sensoren die Luftverschmutzung in verschiedenen Stadtteilen dokumentiert. In Vorarlberg haben Familien über Monate hinweg die Blütezeiten von Wildblumen beobachtet - und damit Hinweise auf den Klimawandel geliefert. Diese Projekte sind nicht nur wissenschaftlich wertvoll, sie verändern auch die Perspektive der Teilnehmer:innen. Wer einmal selbst Daten erhebt, sieht Wissenschaft nicht mehr als etwas Abstraktes, das nur in Universitäten stattfindet.

Wer steht hinter dem Award?
Organisiert wird der Citizen Science Award vom Österreichischen Austauschdienst (OeAD), finanziert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Das ist kein kleiner Nebenjob - es ist eine langfristige Strategie. Seit 2023 ist die Finanzierung durch den Nationalen Aktionsplan für Open Science bis 2028 gesichert, mit jährlich 450.000 Euro. Das zeigt: Österreich will Citizen Science nicht nur als schönes Hobby, sondern als wichtigen Baustein der Wissenschaftsförderung etablieren.Ab 2026 soll ein neues „Zentrum für Citizen Science“ am OeAD starten. Es wird als zentrale Anlaufstelle dienen - für Schulen, die Projekte starten wollen, für Forscher:innen, die Daten brauchen, und für Teilnehmer:innen, die Fragen haben. Das ist ein großer Schritt: Von einem Wettbewerb hin zu einer dauerhaften Infrastruktur.
Wie steht Österreich im internationalen Vergleich?
Österreich ist nicht der Vorreiter in Europa - aber es ist stabil und wächst. Im European Citizen Science Association (ECSA)-Index 2024 belegt Österreich Rang 7 von 27 Ländern. Das ist solide, aber nicht führend. In Deutschland gibt es zum Beispiel Preise mit bis zu 20.000 Euro für das beste Projekt - fast viermal so viel wie in Österreich. Einige Expert:innen, wie Prof. Dr. Anna Schreiner von der Universität Wien, kritisieren das. Sie sagen: Wenn Österreich seine Projekte international sichtbar machen will, muss es mehr Geld in die Preise stecken.Aber es geht nicht nur um Geld. Es geht darum, wie die Projekte aufgebaut sind. Österreich setzt auf breite Teilhabe - nicht auf wenige Eliteprojekte. Das ist ein anderer Ansatz. Und er funktioniert: Im Jahr 2024 haben über 3.000 Menschen an den Projekten mitgewirkt. Das sind doppelt so viele wie im Startjahr 2015.

Was sind die Herausforderungen?
Nicht alles läuft perfekt. Eine Studie von Prof. Dr. Markus Dörler von der BOKU Wien zeigt: Nur 63 % der von Bürger:innen gesammelten Daten sind sofort wissenschaftlich nutzbar. Die restlichen 37 % brauchen Nacharbeit - Korrekturen, Überprüfungen, manchmal sogar neue Messungen. Das ist kein Fehler - das ist normal. Citizen Science ist kein „fertiges“ Produkt, sondern ein Prozess. Die Herausforderung ist, diesen Prozess so zu gestalten, dass die Qualität mit wächst.Die Lösung? Bessere Schulungen, klarere Anleitungen, digitale Tools. Die „AmphiApp“ ist ein Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. Die Nutzer:innen haben eine 4,3 von 5,0 Punkten für die Zufriedenheit mit dem Projekt gegeben. Die meisten loben die klare Anleitung durch die Forscher:innen und den direkten Bezug zur echten Wissenschaft.
Was kommt 2026?
Die Zukunft des Awards ist klar geplant. Ab 2026 gibt es drei große Veränderungen:- Die Preissummen für Schulprojekte werden verdoppelt - also bis zu 2.000 Euro für den ersten Platz.
- Alle Teilnehmer:innen erhalten ein digitales Portfolio, in dem ihre Projekte, Daten und Leistungen gesammelt werden - wie ein Lebenslauf für Wissenschaft.
- Projekte werden nach internationalen ECSA-Richtlinien zertifiziert - das macht sie transparent und vertrauenswürdig.
Diese Schritte zeigen: Österreich will Citizen Science nicht nur feiern - es will sie professionalisieren. Nicht als Hobby, sondern als legitime Form der Forschung.
Warum ist das wichtig?
Weil Wissenschaft nicht nur in Labors stattfindet. Weil die dringendsten Fragen unserer Zeit - Klimawandel, Artensterben, Umweltverschmutzung - nicht von einzelnen Expert:innen gelöst werden können, sondern nur mit der Beteiligung vieler. Citizen Science macht Wissenschaft zugänglich. Sie zeigt: Jeder kann mitmachen. Jeder kann beitragen. Und jeder kann gewinnen - nicht nur mit einem Preis, sondern mit dem Wissen, dass die eigene Beobachtung etwas verändert.Ob du jetzt 10 Jahre alt bist und Frösche hörst, oder 65 und die Blütezeiten von Gänseblümchen dokumentierst - du bist Teil einer Bewegung. Und diese Bewegung hat in Österreich einen Namen: Citizen Science Award. Und er ist bereit, dich zu hören.
Wer kann am Citizen Science Award in Österreich teilnehmen?
Teilnehmen können Schulklassen, Jugendgruppen, Einzelpersonen und Familien. Es gibt keine Altersgrenze - von Kindern bis zu Senioren ab 65 Jahren sind alle willkommen. Die Projekte sind so gestaltet, dass sie für verschiedene Altersgruppen geeignet sind. Die aktive Mitforschung läuft meist zwischen April und Juli.
Wie viel Geld gibt es beim Citizen Science Award?
Für Schulklassen und Jugendgruppen gibt es Geldpreise: 1.000 Euro für Platz 1, 750 Euro für Platz 2 und 500 Euro für Platz 3. Einzelpersonen und Familien erhalten Sachpreise wie Jahreskarten für den Tiergarten Schönbrunn, T-Shirts mit Reptilienmotiven oder Unterstützung von Forschungseinrichtungen wie der BOKU oder dem Naturschutzbund.
Wann läuft der Call für das nächste Jahr?
Der Call für Forschungsprojekte, die am Citizen Science Award 2026 teilnehmen möchten, läuft vom 15. September bis zum 5. November 2025. Danach folgen im März 2026 Online-Einführungsworkshops für Lehrkräfte und Jugendgruppenleiter:innen, bevor die aktive Mitforschungsphase im April beginnt.
Wie viele Menschen nehmen am Award teil?
Im Jahr 2024 haben über 3.000 Menschen an den Projekten mitgewirkt - das sind mehr als doppelt so viele wie im Startjahr 2015. Insgesamt haben seit 2015 bereits über 27.100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene an 73 verschiedenen Projekten mitgeforscht.
Ist Citizen Science in Österreich wissenschaftlich seriös?
Ja. Die Projekte werden von wissenschaftlichen Institutionen wie Universitäten, Forschungszentren oder Naturschutzorganisationen betreut. Die Daten werden von Expert:innen geprüft und in Studien verwendet. Obwohl nur etwa 63 % der Daten ohne Nachbearbeitung nutzbar sind, wird dies durch klare Anleitungen, Schulungen und digitale Tools wie die „AmphiApp“ kontinuierlich verbessert.
Was ist neu im Jahr 2026?
Ab 2026 werden die Preissummen für Schulprojekte verdoppelt, alle Teilnehmer:innen erhalten ein digitales Portfolio mit ihren Leistungen, und Projekte werden nach internationalen ECSA-Richtlinien zertifiziert. Außerdem startet das neue „Zentrum für Citizen Science“ am OeAD als zentrale Anlaufstelle für alle Beteiligten.




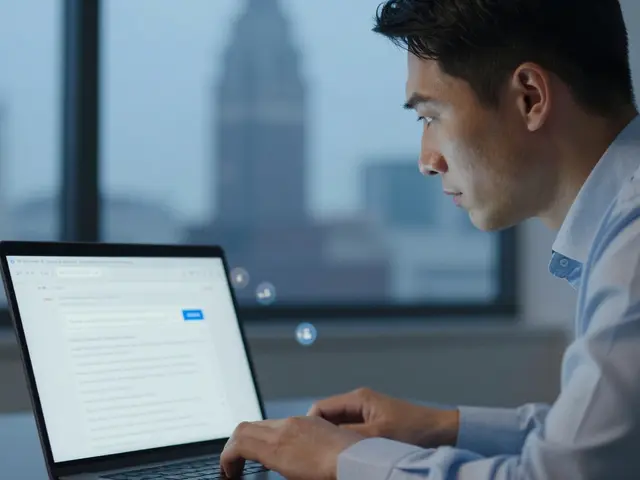

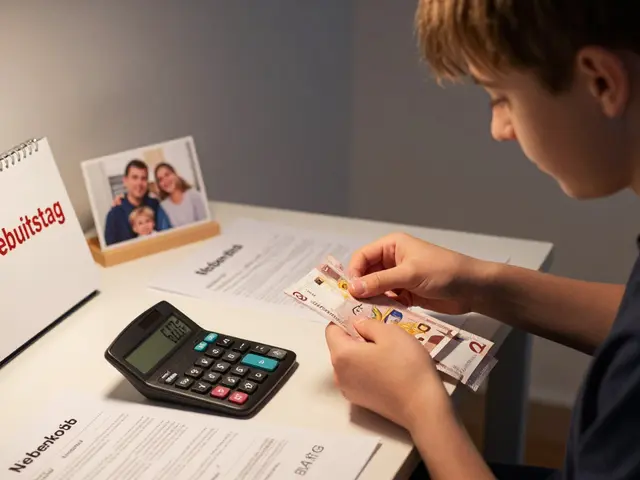
10 Kommentare
Hanna Kim
Endlich mal jemand, der Wissenschaft nicht hinter Glas stellt! Ich hab mit meiner Tochter letztes Jahr bei AmphiBiom mitgemacht – sie hat jetzt nen eigenen Kröten-Tracker auf dem Handy. Kein Spiel, kein Lernen – echte Wissenschaft. Und das mit nem Smartphone. Ich hab Tränen in den Augen gehabt, als sie mir erklärt hat, wie man einen Froschruf von einem Krötenruf unterscheidet. Danke für diese Art von Wissenschaft.
Steffi Hill
Ich find’s einfach nur schön, dass Kinder hier nicht nur lernen, sondern wirklich was bewegen. Kein Stress, kein Druck – nur ne App, ne Karte und ne Neugier. Das ist der wahre Geist von Bildung. Und wenn man dann noch nen T-Shirt mit einer Echse gewinnt, ist das wie ein kleiner Sieg fürs Herz.
Christoffer Sundby
Die 63% nutzbare Datenquote ist kein Mangel, das ist Realität. Jeder, der mal mit Freiwilligen gearbeitet hat, weiß: Qualität wächst mit Vertrauen. Die App hat 4,3 von 5 – das ist mehr als viele Uni-Tools. Hier wird nicht perfektioniert, sondern eingeladen. Und das ist stärker als jede Perfektion.
Gerhard Lehnhoff
2000 Euro für Schulen? 😂 Und dann noch ‘digitales Portfolio’? Also echt jetzt – wir geben 450k pro Jahr aus, damit Kinder ihre Krötenrufe hochladen und dann kriegen sie nen digitalen Lebenslauf? Ich hab ne Cousine, die in Berlin Biochemie macht – die hat 10 Jahre studiert und kriegt kein Portfolio, nur Schulden. 😭
Christian Torrealba
Wissen ist kein Besitz. Es ist ein Feuer, das man weitergibt. Und hier wird es nicht in Laboren gehütet, sondern in Gärten, in Schulhöfen, in Wohnzimmern. Wer einen Frosch hört und ihn aufzeichnet – der hat schon gewonnen. Nicht weil er einen Preis kriegt, sondern weil er plötzlich versteht: Ich bin kein Zuschauer. Ich bin Teil des Ganzen. 🌱🐸
Torolf Bjoerklund
Österreich Rang 7? LMAO. Deutschland hat 20k Euro Preisgeld, Schweiz hat eigene Citizen Science Uni, und wir geben T-Shirts aus? 😂 Das ist nicht Wissenschaft – das ist ein Kindergarten mit Daten. Wer hat das genehmigt? Ein PR-Student?
Hayden Kjelleren
Ich hab die App runtergeladen. Hab 3 Meldungen gemacht. Keine Antwort. Keine Rückmeldung. Kein Feedback. Kein Dank. Kein Portfolio. Nur eine App, die wie ein totes Telefon klingt. Ich hab gewartet. Ich hab gewartet. Und dann? Nichts. War das alles nur für die Fotos?
Christoffer Sundby
Das ist normal. Die ersten 3 Meldungen werden oft nicht direkt geantwortet – die werden erst in der Auswertung berücksichtigt. Aber wenn du deine Daten siehst, wenn sie in der Karte auftauchen – das ist der Moment. Nicht die Antwort. Das Gefühl. Du bist nicht allein. Das ist der Preis.
Nessi Schulz
Die Zertifizierung nach ECSA-Richtlinien ist ein entscheidender Schritt. Bisher war die Transparenz der Datenerhebung in vielen Projekten unzureichend dokumentiert. Mit standardisierten Protokollen, Validierungsprozessen und offenen Metadaten wird Citizen Science in Österreich nun wissenschaftlich fundiert und international vergleichbar. Dies ist kein Marketing, sondern eine notwendige Professionalisierung, die der Sache dient.
Stefan Johansson
Oh Gott, noch so ein ‘wichtiges Projekt’ mit T-Shirts und App-Feedback. 😴 3000 Teilnehmer? Cool. Und wie viele davon haben jemals einen wissenschaftlichen Artikel gelesen? Ich wette, 90% denken, ‘Citizen Science’ ist ein neuer Fitness-Tracker. Wir feiern die Teilnahme, nicht die Ergebnisse. Und das Zentrum? Wird wahrscheinlich von einem Praktikanten betrieben, der noch nie einen Frosch gesehen hat.