Citizen Science in der Stadtentwicklung: Mehr als nur Daten sammeln
Stellen Sie sich vor, Sie können nicht nur beobachten, wie sich Ihr Viertel verändert, sondern selbst entscheiden, welche Probleme wichtig sind. In Österreich wird das Realität. Citizen Science - die Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern an wissenschaftlichen Forschungsprojekten - ist kein Nischenphänomen mehr. In Wien, Graz und Linz gestalten Menschen aktiv die Zukunft ihrer Städte. Sie messen Lärm, kartieren Hitzeinseln, dokumentieren barrierefreie Wege und melden, wo es an Sicherheit fehlt. Diese Daten landen nicht in einer Schublade. Sie fließen direkt in die Planung von Straßen, Parks und Wohngebieten ein.
Wie funktioniert Citizen Science in österreichischen Städten?
Es gibt keine einzige Methode. Vielmehr kombinieren Projekte digitale Tools mit persönlichen Gesprächen. Die App City Layers, entwickelt vom Österreichischen Wissenschaftsfonds, ist ein Beispiel dafür. Seit 2021 können Nutzer*innen in Wien verschiedene „Schichten“ ihrer Stadt erfassen: Wie gut ist die Barrierefreiheit? Wie laut ist es an der Ecke? Wie sicher fühlt man sich nachts? Die Antworten werden mit GPS-Ortung gespeichert und anonymisiert aggregiert. So entsteht ein lebendiges Bild, das Stadtverwaltungen sonst nicht hätten.
Neben Apps gibt es Workshops, Spaziergänge und lokale Treffen. Im 6. Bezirk von Wien, in Gumpendorf, haben Forscher*innen der TU Wien mit Alleinerziehenden und Jugendlichen gemeinsam die Gumpendorfer Straße neu gedacht. Sie führten Interviews, machten Fotos und schrieben Briefe an die Stadt. Ergebnis: Die Teilnahmequote lag bei 78 % - weit über dem Durchschnitt von 35 % bei herkömmlichen Beteiligungsverfahren. Warum? Weil sie flexible Zeiten anboten, Kinderbetreuung organisierten und nicht nur digital, sondern auch analog arbeiteten.
Wer ist dabei? Universitäten, Museen und die Stadtverwaltung
Die größten Akteure sind klar: Die TU Wien führt mit 17 Projekten die Liste an. Das OeAD-Zentrum für Citizen Science koordiniert 12 Projekte. Die Stadt Wien selbst hat 24 Initiativen angestoßen. Doch etwas Besonderes passiert in Österreich: Museen und Bibliotheken werden zu Wissenszentren. Das Naturhistorische Museum Wien, das MAK und das MUMOK arbeiten mit der Stadtverwaltung zusammen. Sie bieten Räume, Fachwissen und Vertrauen - besonders für Menschen, die sich sonst nicht an Planungsprozessen beteiligen.
Das internationale Projekt OPUSH, an dem die TU Wien Bibliothek mit Partnern aus Barcelona und Tallinn beteiligt ist, hat 2024 einen Workshop mit 50 Expert*innen aus Wiener Behörden und Kulturinstitutionen organisiert. Ziel: Ein gemeinsames Datenmanagementsystem bis Ende 2024 aufzubauen. Das ist neu. Bisher wurden Daten oft isoliert gesammelt. Jetzt sollen sie zusammengeführt werden - zwischen Stadtverwaltung, Museen und Bürgern.

Was funktioniert gut - und was nicht?
Die Zahlen sprechen für sich: Zwischen 2019 und 2024 ist die Zahl der Citizen Science-Projekte in Österreich von 30 auf 85 gestiegen. Wien hat mit 37 Projekten die Nase vorn, Graz folgt mit 12, Linz mit 9. Die Finanzierung kommt hauptsächlich aus öffentlichen Mitteln - 68 % werden vom Bund oder den Gemeinden getragen. Die EU fördert 22 %, private Spenden spielen kaum eine Rolle.
Ein großer Erfolg ist die Einbindung marginalisierter Gruppen. In Gumpendorf stieg die Teilnahme von Alleinerziehenden von 22 % auf 67 %, als Kinderbetreuung angeboten wurde. In Leopoldau hingegen nahmen nur 28 % der Menschen mit Migrationshintergrund an Workshops teil - weil die Kommunikation nicht sprachlich angepasst war.
Die größte Schwäche? Die Verwaltung kommt nicht hinterher. Nur 42 % der gesammelten Daten fließen in die finale Planung ein. Warum? Weil Mitarbeiter*innen in den Ämtern keine Zeit haben, die Ergebnisse auszuwerten oder zu verarbeiten. Einige Bürger*innen beschweren sich auf Reddit: „Die Ergebnisse landen im Niemandsland.“
Warum ist Transparenz so wichtig?
Ein Projekt kann noch so gut geplant sein - wenn die Menschen nicht wissen, was mit ihren Daten passiert, verliert es Vertrauen. Dr. Eva Maria Kail, Stadtplanerin der Stadt Wien, warnte 2024: „Ohne klare Rückmeldung können Citizen Science-Projekte das Vertrauen der Bevölkerung untergraben.“ Tatsächlich sank die Teilnahmequote in Projekten ohne transparente Feedback-Systeme zwischen 2021 und 2023 um 18 %.
Die Lösung? Klare Regeln. Wer hat die Daten? Wer nutzt sie? Was passiert mit den Ergebnissen? In der Strategie „Citizen Science 2024-2028“ der Stadt Wien wurde das jetzt festgeschrieben: Jedes Projekt muss einen Bericht veröffentlichen, der erklärt, was mit den Daten passiert ist. Und: Die Stadt hat 1,2 Millionen Euro pro Jahr für diese Projekte bereitgestellt - eine Verdreifachung gegenüber 2021.

Was braucht es, um Citizen Science erfolgreich zu machen?
Es geht nicht nur um Technik. Es geht um Prozesse. Der Leitfaden des OeAD sagt: Eine erfolgreiche Integration dauert durchschnittlich 14 Monate. Die ersten drei Monate müssen für die klare Fragestellung verwendet werden: Was genau wollen wir herausfinden? Die nächsten fünf Monate für die Teilnehmer*innenrekrutierung. Monate 7 bis 12 sind entscheidend: Hier muss kontinuierlich mit den Menschen kommuniziert werden - nicht nur am Anfang und am Ende.
Die TU Wien hat dafür den „Participation Readiness Check“ entwickelt. Ein Tool, das Stadtverwaltungen helfen soll, ihre eigene Bereitschaft zu prüfen. In einem Pilotprojekt mit der MA 22 (Wiener Stadtentwicklungsamt) verkürzte sich die Vorbereitungszeit um 30 %. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Was kommt als Nächstes?
2024 wurde der erste „CiTizenScience Award“ ausgerufen - mit 50.000 Euro Preisgeld für Projekte, die besonders marginalisierte Gruppen einbinden. Das ist ein Signal: Es geht nicht mehr nur um Daten. Es geht um Gerechtigkeit. Um Teilhabe. Um Macht.
Experten wie Prof. Dr. Markus Schmidt prognostizieren: Bis 2030 wird Citizen Science Standard in der österreichischen Stadtplanung sein. Die Bürgerbeteiligung wird von heute 35 % auf mindestens 65 % steigen - vorausgesetzt, die Verwaltung lernt, mit den Daten umzugehen. Die Stadt Wien hat bereits die Grundlage gelegt. Jetzt kommt es darauf an, dass andere Städte nachziehen und dass die Menschen, die mitmachen, auch gehört werden.
Wie können Sie mitmachen?
- Suchen Sie nach Citizen Science-Projekten in Ihrer Stadt auf osterreichforscht.at.
- Probieren Sie die City Layers-App aus - auch wenn Sie nur eine Sache melden: Wo ist der Gehweg kaputt? Wo ist es zu laut?
- Reden Sie mit Ihrer Gemeinde: Haben Sie schon einmal nachgefragt, ob es ein Citizen Science-Projekt in Ihrer Nachbarschaft gibt?
- Unterstützen Sie lokale Museen und Bibliotheken - sie sind oft die ersten Anlaufstellen für Bürgerbeteiligung.
Es geht nicht darum, ein Wissenschaftler zu werden. Es geht darum, ein Teil der Stadt zu sein - und zu sagen: Ich habe etwas zu sagen.






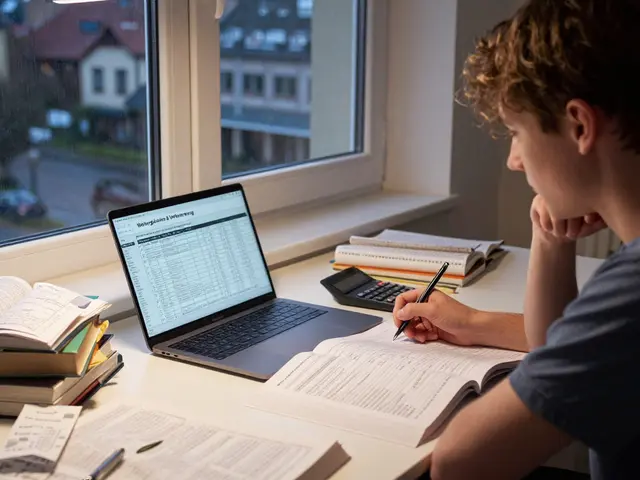
13 Kommentare
Steffen Ebbesen
Das ist alles schön und gut, aber wer bezahlt die 14 Monate, die jede Stadt für 'Participation Readiness' opfern muss? Die Bürger sollen mitmachen, aber die Verwaltung hat keine Zeit, die Daten zu verarbeiten. Klassische Hypokrisie.
Oliver Sy
Die Integration von Citizen Science in die Stadtplanung ist ein Meilenstein in der partizipativen Governance. Die aggregierten Daten aus City Layers bieten eine hochauflösende, georeferenzierte Datensicht, die traditionelle Survey-Methoden bei Weitem übertrifft. Die Kombination aus digitaler Erfassung und analoger Community-Engagement-Strategie ist ein Modellfall für den europäischen Kontext. Die TU Wien hat hier eine benchmark-definierende Rolle übernommen.
Rosemarie Felix
Und wieder ein Projekt, das nur von Leuten gemacht wird, die schon genug Zeit haben. Ich arbeite zwei Jobs und habe keine 3 Stunden pro Woche, um Gehwege zu fotografieren. Danke, aber nein.
Jade Robson
Ich finde es toll, dass auch Alleinerziehende und Migrant*innen eingebunden werden. Ich hab letztes Jahr bei einem Projekt in Neubau mitgemacht – die Kinderbetreuung war ein Gamechanger. Endlich fühlt man sich nicht wie ein Störfaktor, sondern wie ein Teil der Stadt.
Stephan Brass
Citizen Science? Nennt man das nicht früher einfach nur Bürgermecker? Ich hab auch mal 'zu laut' gemeldet. Antwort: 'Danke für Ihr Feedback, wir prüfen es.' Kein Ergebnis. Kein Update. Kein Interesse. Das ist nicht Partizipation, das ist psychologische Manipulation.
Frank Wöckener
Hört auf mit dem ganzen Gerede. Wer will schon mitmachen, wenn die Stadtverwaltung nicht mal die Straßenlaternen repariert? Ich hab 3x 'kaputter Gehweg' gemeldet. Seit 18 Monaten liegt der Beton noch da. Citizen Science ist nur eine PR-Show für Akademiker.
Markus Steinsland
Die Datenintegration zwischen Stadt, Museen und Universitäten ist der entscheidende Hebel. Ohne interoperable Datenarchitekturen bleibt Citizen Science ein silo-basiertes Schönwetterprojekt. Die OPUSH-Initiative ist der erste Ansatz, der über den reinen Datensammelwahn hinausgeht – aber die Governance-Struktur bleibt fragil.
Lea Harvey
Warum muss das alles von der EU oder der TU Wien gesteuert werden? Wir haben doch auch eigene Bürger, die wissen, was gut ist. Statt Apps und Workshops brauchen wir mehr Autorität, nicht mehr Beteiligung. Die Leute sollen einfach folgen, nicht abstimmen.
Markus Fritsche
Manchmal frag ich mich, ob wir nicht zu viel denken. Es geht doch nur darum, dass jemand den Gehweg repariert. Ob das jetzt mit GPS oder mit einem Brief an den Bürgermeister passiert – Hauptsache, es passiert. Die ganze Wissenschaftssprache macht es nur komplizierter. Einfach mal hingehen und sagen: Hier ist was kaputt. Und dann hoffen, dass jemand hört.
Matthias Kaiblinger
Was hier in Wien passiert, ist nicht nur österreichisch – das ist ein europäisches Leitbild. In Belgien oder den Niederlanden würde man solche Projekte als revolutionär bezeichnen. Die Einbindung von Museen als Wissensvermittler ist genius. Sie vermitteln Vertrauen, wo die Stadtverwaltung nur Bürokratie ist. Und ja – ich hab auch mal mitgemacht. Ich hab die Lärmmessung in meiner Straße gemacht. Kein Witz – es hat sich was geändert. Ein Tempo-30-Schild kam. Nicht wegen der App. Sondern weil die Stadt merkte: Die Leute sind wach.
Kari Viitanen
Ich komme aus Norwegen, und ich muss sagen: Die Transparenzvorgaben in Wien sind beeindruckend. In Oslo haben wir zwar auch Citizen Science, aber keine verpflichtende öffentliche Rückmeldung. Die 1,2 Millionen Euro jährlich sind ein klares Signal – und die Fristen für Berichterstattung sind endlich realistisch. Ein Modell, das andere Länder kopieren sollten.
Quinten Peeters
Ich find das alles total überflüssig. In Belgien machen wir das anders. Wir reden mit den Leuten, nicht mit Apps. Und wenn jemand was sagt, dann wird’s gemacht – ohne 14 Monate Vorbereitung. Warum muss immer alles so kompliziert sein?
Sven Schoop
Ihr alle denkt, das ist Demokratie. Aber es ist nur eine neue Form der Kontrolle: Die Stadt sammelt Daten, um später zu entscheiden, was sie ignorieren will. Ich hab 47 Mal 'fehlende Beleuchtung' gemeldet. Keine Antwort. Keine Aktion. Nur ein 'Danke für Ihre Teilnahme'. Das ist keine Partizipation. Das ist Datenklau mit freundlichem Lächeln.