Wie misst Österreich wirklich, wer eine faire Chance hat?
Stell dir vor, du bist 16, hast einen Migrationshintergrund, deine Eltern haben keinen Schulabschluss, und du lebst in einem Dorf in der Steiermark. Hast du die gleiche Chance auf einen guten Abschluss wie jemand aus einer Akademikerfamilie in Wien? In Österreich wird diese Frage nicht mehr nur gefühlt beantwortet - sie wird gemessen. Mit über 260 Indikatoren versucht das Land, sichtbar zu machen, wo Chancen fair verteilt sind - und wo nicht. Doch was steckt hinter diesen Zahlen? Und warum fühlen sich viele Betroffene trotzdem nicht gesehen?
Was bedeutet Chancengleichheit in Österreich eigentlich?
Chancengleichheit bedeutet nicht, dass jeder das Gleiche bekommt. Es bedeutet: Wer gleich talentiert ist, sollte auch die gleichen Möglichkeiten haben - egal, woher er kommt, welches Geschlecht er hat oder ob er eine Behinderung hat. Diese Definition stammt aus der Forschung von Fend (2009) und ist heute Grundlage aller offiziellen Messungen. Die österreichische Regierung nutzt sie, um zu prüfen, ob das Bildungssystem, der Arbeitsmarkt oder die Sozialsysteme wirklich fair funktionieren. Doch die Realität sieht anders aus.
Ein Beispiel: 2023 erreichten 91,5 % der 20- bis 24-Jährigen ohne Migrationshintergrund einen Sekundarstufe-II-Abschluss. Bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund waren es nur 78,3 %. Das ist kein Zufall. Das ist ein Systemefekt. Und genau das soll gemessen werden - nicht nur, um zu zeigen, dass es Ungleichheit gibt, sondern um zu wissen, wo man ansetzen muss.
Die drei wichtigsten Bereiche: Einkommen, Bildung, Arbeit
Statistik Austria, das Bundeskanzleramt und das Ministerium für Frauen und Jugend arbeiten zusammen, um die wichtigsten Ungleichheiten zu erfassen. Drei Bereiche stehen im Fokus: Einkommen, Bildung und Erwerbsbeteiligung.
Einkommen: Der Gini-Koeffizient misst, wie ungleich Einkommen verteilt sind. In Österreich lag er 2022 bei 29,9 - unverändert seit 2010. Das klingt stabil, ist es aber nicht. Der Armutsgefährdungsquotenwert stieg von 13,3 % im Jahr 2010 auf 14,9 % im Jahr 2023. Wer arm ist, bleibt oft arm. Und wer mit Migrationshintergrund aufwächst, hat mit 18,5 % fast doppelt so hohe Armutsrisiken wie jemand ohne. Der Gini-Koeffizient sagt nicht, wer arm ist. Nur, dass die Kluft bleibt.
Bildung: Hier ist Österreich ein Problemkind. Im PISA-Test 2018 hatte Österreich den stärksten sozialen Gradienten in ganz Europa: 78 Punkte. Das bedeutet: Kinder aus sozial benachteiligten Familien lagen fast acht Schuljahre hinter ihren privilegierten Mitschülern. Der OECD-Durchschnitt lag bei 59. Österreich belegte Platz 28 von 37 Ländern. Das ist kein Erfolg. Das ist ein Versagen. Und es wird nicht besser, weil die Daten nicht detailliert genug sind. Wer genau? Aus welchem Land? Mit welcher Sprache zu Hause? Das wird kaum erfasst.
Arbeit: Der Gender Pay Gap beträgt 19,3 % brutto, 10,4 % bereinigt. Das heißt: Frauen verdienen im Schnitt fast ein Fünftel weniger als Männer - selbst wenn sie die gleiche Arbeit machen. Noch schlimmer: Frauen übernehmen 62,3 % der unbezahlten Arbeit - Kinderbetreuung, Haushalt, Pflege. Das ist kein Naturgesetz. Das ist eine strukturelle Ungleichheit, die sich in den Zahlen widerspiegelt. Und sie wird oft ignoriert, weil sie nicht in den Arbeitsstatistiken steht.
Wer bleibt auf der Strecke? Menschen mit Behinderung, LGBTQI+ und Migrant:innen
Chancengleichheit ist nicht nur ein Geschlechterproblem. Es ist auch ein Problem von Menschen mit Behinderung, von LGBTQI+-Personen und von Migrant:innen - und oft ist es ein Problem von allen drei gleichzeitig. Doch das wird kaum gemessen.
Die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit schwerer Behinderung liegt bei nur 18,9 %. Das ist kein Versagen der Betroffenen. Das ist ein Versagen des Systems. Wo sind die barrierefreien Arbeitsplätze? Wer sorgt für die notwendige Unterstützung? Die Daten sagen es nicht. Nur: 68 % der Gleichstellungsbeauftragten in Österreich sagen, die Indikatoren reichen nicht aus, um die Situation von Menschen mit Behinderung richtig zu erfassen.
Bei LGBTQI+-Personen gibt es fast keine Daten. Die Europäische Kommission sagt es klar: Die Lücken bei der Messung von Diskriminierungserfahrungen sind gravierend. Keine Studie fragt, ob eine lesbische Lehrerin in Tirol benachteiligt wird. Keine Statistik erfasst, ob ein trans Mann in einem Betrieb in Linz nicht befördert wird. Ohne Daten gibt es keine Politik. Und ohne Politik gibt es keine Veränderung.
Und bei Migrant:innen? Die Wahlbeteiligung liegt bei nur 45,3 % - weit unter dem EU-Durchschnitt von 58,7 %. Warum? Weil sie sich nicht angesprochen fühlen. Weil sie nicht wissen, wie sie wählen können. Weil sie keine Stimme haben. Und weil niemand das messen will.
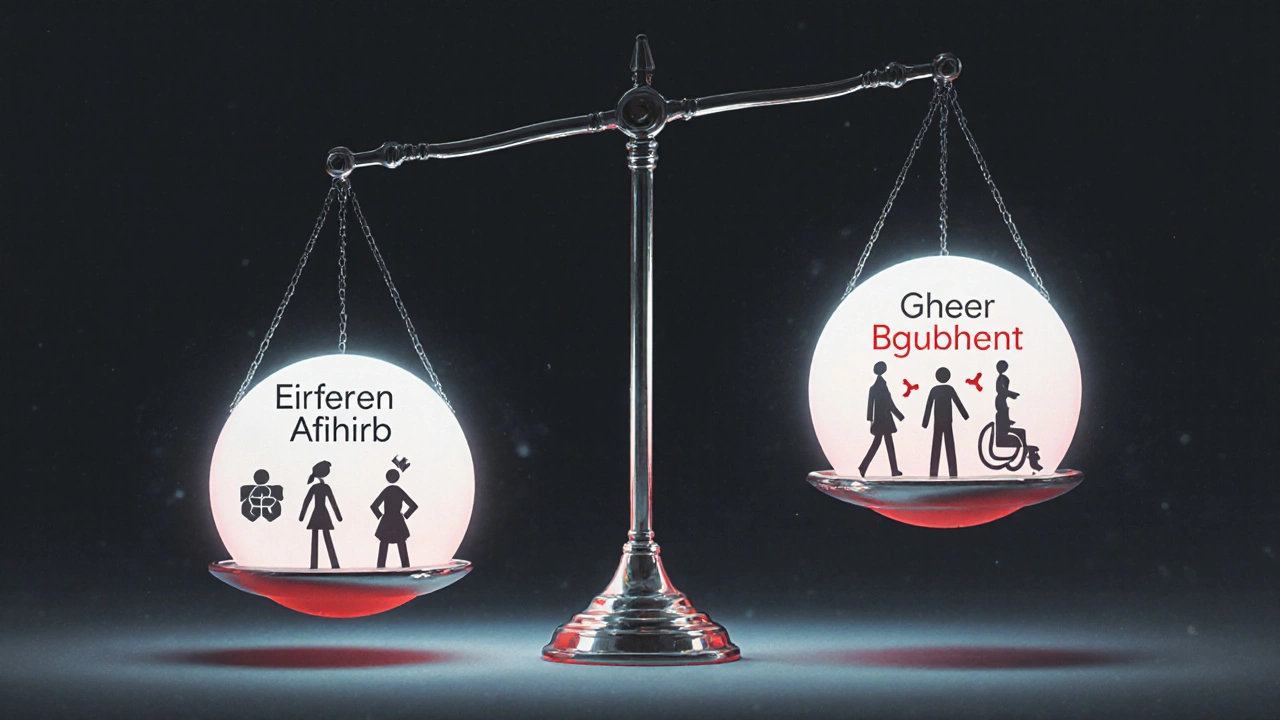
Wie gut ist Österreich im EU-Vergleich?
Österreich ist kein Schlusslicht - aber auch kein Vorreiter. Im European Gender Equality Index 2023 belegt es Platz 13 von 27 EU-Ländern mit 68,1 von 100 Punkten. Schweden hat 83,9. Deutschland 71,2. Österreich liegt zwischen Österreich und Italien. Das ist Mittelmaß. Und Mittelmaß reicht nicht.
Beim Einkommen ist Österreich gut. Die jährliche Armutsberichterstattung seit 1995 ist europaweit einmalig. Das ist ein echter Pluspunkt. Aber bei Bildung? Da ist Österreich das Schlusslicht. Bei digitaler Teilhabe? Nur 35 % der relevanten Indikatoren sind erfasst - der EU-Durchschnitt liegt bei 52 %. Und bei politischer Teilhabe? Fast keine Daten.
Die Europäische Kommission sagt es klar: Österreich braucht dringend bessere Daten zu Diskriminierung, zu LGBTQI+-Personen und zu mehrfachbenachteiligten Gruppen. Sonst kann keine Politik wirken.
Was funktioniert - und was nicht?
Ein Erfolg ist das interaktive Dashboard von Statistik Austria. Seit 2021 nutzen über 12.000 Menschen monatlich die Plattform, um Indikatoren selbst zu erkunden. Das ist modern, transparent und nutzerfreundlich. Auch die jährlichen Schulungen für Behördenmitarbeiter:innen (8 Stunden, kostenlos, 250 Teilnehmer:innen pro Jahr) helfen, die Daten zu verstehen.
Aber das reicht nicht. Die Daten sind zu aggregiert. Zu wenig zerlegt. Ein Beispiel: Du willst wissen, wie es um die Bildungschancen von Mädchen mit Migrationshintergrund aus der Türkei in Niederösterreich steht? Gibt es keine Zahl. Warum? Weil die Daten nur nach einem Merkmal aufgeschlüsselt werden - entweder Geschlecht, oder Migration, oder Region. Nie alle drei gleichzeitig. Nur 12 % der Indikatoren sind nach mindestens drei Merkmalen disaggregiert. Das ist kein Zufall. Das ist ein Systemfehler.
Und dann ist da noch die Zeit. Einkommensdaten kommen jährlich. Bildungsdaten alle drei Jahre. Was passiert zwischen den Erhebungen? Niemand weiß es. Die Politik reagiert mit Verzögerung. Und die Betroffenen warten - oft jahrelang.
Was kommt als Nächstes? Neue Indikatoren, neue Herausforderungen
Im März 2024 wurde das neue Chancenmonitor Österreich gestartet. Es misst Chancen über die gesamte Lebensspanne - von der Kindheit bis ins Alter. 89 Indikatoren, 17 Lebensbereiche. Das ist ein großer Schritt. Endlich wird nicht nur die Schule, sondern auch die Familie, die Gesundheit, die Wohnung und die Freizeit betrachtet.
Ab 2025 soll ein neuer Indikator zur sozialen Mobilität eingeführt werden - basierend auf der Geschwisterkorrelation. Das heißt: Wenn ein Bruder oder eine Schwester aus einer armen Familie es schafft, in die Mittelschicht aufzusteigen, wie wahrscheinlich ist das für den anderen? Das ist ein cleverer Ansatz. Er zeigt, ob das System wirklich Chancen eröffnet - oder nur die gleichen Familien immer wieder erfolgreich macht.
Und ab 2026 wird die unbezahlte Arbeit erstmals geschlechts- und migrationshintergrundspezifisch erfasst. Das ist ein Meilenstein. Denn bislang wurde sie als „natürlich“ ignoriert. Jetzt wird sie sichtbar. Und damit wird auch klar: Wer unbezahlte Arbeit leistet, hat weniger Zeit für Bildung, Arbeit, Politik. Und das ist ein struktureller Nachteil.

Was können Betroffene tun?
Du bist kein Statistiker? Du hast keine Datenbank? Du willst trotzdem etwas ändern? Dann nutze das ChancenCheck Österreich vom Bundeskanzleramt. Es dauert 15 Minuten. Du beantwortest Fragen zu deinem Hintergrund, deiner Bildung, deinem Einkommen - und bekommst eine persönliche Einschätzung. 42.315 Menschen haben es 2023 genutzt. Es ist kein Ersatz für Systemveränderung - aber es ist ein erster Schritt, um zu sehen: Du bist nicht allein.
Und wenn du in einer Behörde arbeitest, in einer Schule, in einem Verein: Fordere die Daten an. Frag nach Zahlen, die nach mehreren Merkmalen aufgeschlüsselt sind. Nutze das Scientific Use File der Sozioökonomischen Panelstudie - wenn du die Genehmigung bekommst. Es dauert 45 Tage. Aber es lohnt sich.
Chancengleichheit ist kein Ziel, das man irgendwann erreicht. Sie ist ein Prozess. Und er beginnt mit der Frage: Wer ist unsichtbar? Und warum sehen wir ihn nicht?
Was fehlt noch? Die großen Lücken
Es gibt drei große Lücken, die Österreich dringend schließen muss:
- Daten zu mehrfachen Benachteiligungen: Wer ist gleichzeitig Frau, Migrantin und hat eine Behinderung? Keine Daten. Keine Politik.
- Diskriminierungserfahrungen: Wer wurde im Job abgelehnt, weil er einen ausländischen Namen hat? Wer wurde in der Schule gemobbt, weil er queer ist? Das wird nicht erfasst.
- Digitaler Zugang: Wer hat keinen Internetzugang? Wer kann keine Online-Bildung nutzen? Wer hat keinen Computer zu Hause? Das ist heute ein zentraler Teil von Chancengleichheit - und wird fast ignoriert.
Ohne diese Daten bleibt Chancengleichheit ein leeres Wort. Und das ist nicht nur unfair. Das ist gefährlich. Denn wer sich nicht gesehen fühlt, hört auf, zu glauben, dass es Veränderung gibt.
Was kannst du tun?
Wenn du in Österreich lebst, arbeitest oder studierst: Frag nach. Frag nach den Zahlen. Frag nach den Lücken. Und wenn du sie nicht findest - dann sag es laut. Denn Chancengleichheit wird nicht von oben verordnet. Sie wird von unten erkämpft. Mit Daten. Mit Stimmen. Mit Wissen.
Wie werden Chancengleichheitsindikatoren in Österreich erhoben?
Die wichtigsten Daten kommen von Statistik Austria, in Zusammenarbeit mit dem Bundeskanzleramt und mehreren Ministerien. Sie nutzen nationale Erhebungen wie die Mikrozensus- und die Zeitverwendungserhebung, aber auch internationale Studien wie PISA. Die Daten werden jährlich aktualisiert, meist bis zum 15. Juni. Für spezifische Analysen gibt es das Scientific Use File der Sozioökonomischen Panelstudie (SOS), das aber eine Genehmigung erfordert.
Warum ist der Gini-Koeffizient bei 29,9 - und das seit 2010?
Der Gini-Koeffizient misst die Einkommensverteilung, nicht die Armutsquote. Seit 2010 haben Steuer- und Sozialpolitik die Einkommensverteilung stabilisiert - aber nicht verbessert. Die Armutsgefährdungsquote ist gestiegen, weil die Lebenshaltungskosten höher sind, während die Einkommen nicht gleich stark gewachsen sind. Der Gini-Wert sagt also: Die Kluft bleibt gleich groß, aber mehr Menschen sind in der unteren Hälfte.
Warum ist Österreich bei Bildungsgerechtigkeit so schlecht?
Weil das Bildungssystem sehr früh selektiert. Mit 10 Jahren werden Kinder in verschiedene Schulformen aufgeteilt - und die Herkunft entscheidet oft mehr als die Begabung. Die PISA-Daten zeigen: Kinder aus akademischen Familien haben eine 5-mal höhere Chance auf ein Gymnasium. Die Struktur des Systems fördert Ungleichheit - nicht Chancengleichheit.
Gibt es eine App oder ein Tool, um meine eigene Chancensituation zu prüfen?
Ja. Das Bundeskanzleramt bietet das interaktive Tool „ChancenCheck Österreich“ an. Du beantwortest 10-15 Fragen zu deiner Bildung, deiner Herkunft, deinem Einkommen und deinem Wohnort. In 15 Minuten bekommst du eine Einschätzung, wie deine Chancen im Vergleich zum Durchschnitt liegen. Es ist kostenlos, anonym und für alle zugänglich. Im Jahr 2023 wurde es über 42.000 Mal genutzt.
Warum werden LGBTQI+-Personen nicht in den Indikatoren erfasst?
Weil es keine offiziellen Erhebungen gibt, die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität abfragen. Die meisten Umfragen fragen nur nach Geschlecht (männlich/weiblich). Das ist ein systematischer Datenfehler. Die Europäische Kommission hat Österreich 2023 explizit aufgefordert, diese Lücke zu schließen - bislang ohne konkrete Maßnahme. Ohne Daten gibt es keine Rechte.
Wo kann ich die Daten selbst herunterladen?
Auf der Website von Statistik Austria (statistik.at) gibt es ein öffentliches Dashboard mit über 120 Indikatoren. Für detailliertere Analysen (z. B. nach Alter, Geschlecht und Migrationshintergrund) musst du das Scientific Use File der Sozioökonomischen Panelstudie (SOS) beantragen. Das dauert etwa 45 Tage und erfordert eine Datenschutzgenehmigung. Für die meisten Nutzer:innen reicht das öffentliche Dashboard.




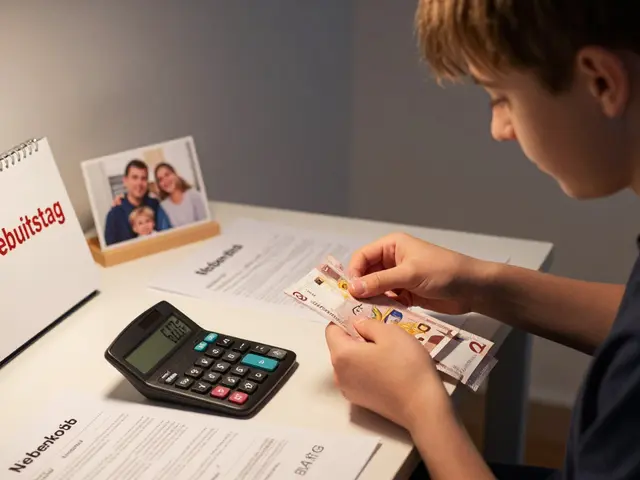
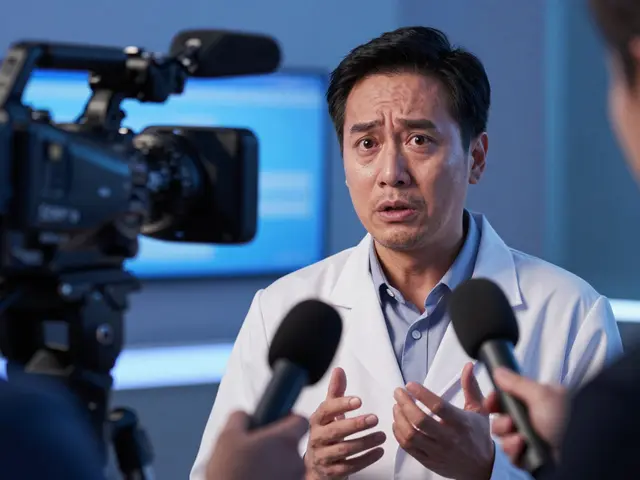

12 Kommentare
Stefanie Barigand
Endlich mal jemand, der die Wahrheit sagt! Aber wer hat denn jetzt noch Zeit, sich mit diesen ganzen Statistiken auseinanderzusetzen? Die Leute sollen einfach arbeiten, statt sich als Opfer zu fühlen. Und warum muss man immer alles mit Migration verknüpfen? Ich hab auch keinen Abschluss, aber ich hab trotzdem was auf die Beine gestellt. Einfach mal aufhören, immer die Schuld bei anderen zu suchen!
Und wer zum Teufel braucht noch einen Indikator für LGBTQI+? Das ist doch nur politisch korrekte Überfrachtung. Österreich ist kein Labor für Gender-Experimente!
Hayden Kjelleren
Ich wohne in Norwegen. Hier messen wir auch Chancen. Aber wir machen es anders. Wir geben mehr Geld an die, die es brauchen. Keine komplizierten Indizes. Einfach helfen. Die Daten hier sind schön – aber sie ändern nichts. Nur weil man sie misst, heißt das nicht, dass man sie löst.
Hanna Kim
Das ist endlich mal ein Text, der nicht nur klagt, sondern auch Lösungen zeigt. Das ChancenCheck-Tool ist ein kleiner, aber riesiger Schritt. Ich hab’s selbst ausprobiert – und war überrascht, wie genau es trifft. Wer sagt, dass Statistiken kalt sind? Sie zeigen Menschen. Und Menschen verdienen gesehen zu werden.
Bitte teilt das. Mit jemandem, der denkt, das sei alles übertrieben.
Nessi Schulz
Die Datenqualität in Österreich ist leider oft unzureichend. Die Aggregation auf nur ein oder zwei Merkmale macht viele Analysen irrelevant. Eine korrekte disaggregierte Auswertung nach mehreren Dimensionen (z.B. Geschlecht + Migration + Region + Bildungsstand) ist notwendig, um echte Ungleichheitsmuster zu erkennen. Ohne diese ist jede Politik blind.
Die Nutzung des Scientific Use File der SOS ist zwar administrativ aufwendig, aber unverzichtbar für fundierte Forschung. Es ist bedauerlich, dass dies nicht standardisiert in Behörden integriert ist.
Steffi Hill
Ich find’s gut, dass jemand endlich nachfragt. Ich hab mal mit einer Freundin aus der Türkei geredet – sie sagt, sie fühlt sich in der Schule nie wirklich willkommen. Keiner fragt, was sie braucht. Nur ob sie Deutsch kann. Vielleicht ist das der Punkt? Nicht die Zahlen, sondern die Menschen dahinter.
Christian Torrealba
Chancengleichheit ist wie ein Spiegel. Wenn du dich nicht darin erkennst, fragst du dich: Liegt es an mir? Oder an dem Spiegel? 🤔
Wir messen alles – aber wer misst, wie es sich anfühlt, wenn man 16 ist, und niemand glaubt, dass du es schaffen kannst? Die Zahlen sagen: 78,3%. Aber die Herzen sagen: Ich bin nicht genug. Und das ist das, was wir wirklich ändern müssen.
Torolf Bjoerklund
Haha. Chancengleichheit. Was für ein Märchen. In der echten Welt gewinnt der, der die stärksten Eltern hat. Die anderen sind nur Zuschauer. Ihr misst alles – aber wer misst die Müdigkeit der Menschen, die jeden Tag kämpfen, ohne dass jemand ihnen zuhört? Die Daten sind nur ein Ablenkungsmanöver. Die Systeme bleiben gleich. Und das ist die Wahrheit.
Stefan Johansson
Oh wow. 260 Indikatoren. Und immer noch kein Mensch, der fragt: Warum muss man in Österreich 10 Jahre alt sein, um zu wissen, ob man ein Gymnasium schafft? Weil das System absichtlich so gebaut ist. Es ist kein Fehler. Es ist ein Feature.
Und jetzt wollen sie noch die unbezahlte Arbeit messen? Geile Idee. Dann können wir auch die Anzahl der Tränen pro Haushalt erfassen. 😂
Wirklich. Wir brauchen keine neuen Indizes. Wir brauchen eine Revolution. Und die kommt nicht von Statistik Austria.
Christoffer Sundby
Ich hab in Norwegen gearbeitet, wo man wirklich investiert – nicht in Daten, sondern in Menschen. Ein Lehrer, der 30 Minuten extra mit einem Kind spricht. Ein Mentor, der sagt: Du kannst das. Das ist es, was zählt. Die Zahlen zeigen nur, wo es weh tut. Aber die Herzen zeigen, wie man heilt.
Wenn du in Österreich bist: Sag jemandem heute, dass er es schafft. Einfach so. Ohne Daten. Ohne Indikator. Nur mit Worten.
Jamie Baeyens
Das ist das Problem mit Deutschland und Österreich: Ihr denkt, ihr könnt Ungleichheit mit Excel-Tabellen heilen. Aber ihr ignoriert die Moral. Wer hat das Recht, zu entscheiden, was eine 'faire Chance' ist? Wer hat euch das Mandat gegeben? Ihr misst, aber ihr urteilt nicht. Und das ist noch gefährlicher, als die Ungleichheit selbst.
Chancengleichheit ist kein statistisches Ziel. Es ist eine ethische Verpflichtung. Und ihr versteht sie nicht.
Gerhard Lehnhoff
LMAO. 260 Indikatoren und immer noch keine Ahnung, warum die meisten Jugendlichen in der Steiermark aufgeben. Weil sie merken: Es gibt keinen Ausweg. Kein Geld. Keine Zukunft. Kein Wort von jemandem, der sagt: Ich hab’s auch geschafft.
Und jetzt wollen sie noch die unbezahlte Arbeit messen? Geile Idee. Dann kann man ja auch die Anzahl der Kaffeebecher pro Mutter zählen. 😭
Die Wahrheit? Die Daten sind ein Luxus. Die Menschen brauchen Jobs. Und zwar jetzt. Nicht nächste Woche. Nicht in 2026.
Hanna Kim
Gerhard, du hast recht – die Daten allein reichen nicht. Aber sie sind der erste Schritt, um zu sehen, wo wir anfangen müssen. Ohne sie bleibt es bei 'Ich hab’s doch auch geschafft' – und das ist genau das, was die Systeme am Leben hält. Ich hab mit einer 17-Jährigen gesprochen, die in einem Dorf lebt, Mutter alleinerziehend, kein Internet zu Hause. Sie hat das ChancenCheck-Tool genutzt. Sie hat geweint. Und dann hat sie gesagt: 'Ich bin nicht allein.'
Das ist der Punkt. Nicht die Zahlen. Die Menschlichkeit dahinter.