Was passiert wirklich in der Kita, wenn ein Kind zum ersten Mal einen Turm aus sieben Klötzen baut? Wer hat diesen Moment gesehen? Wer hat ihn aufgeschrieben? Und warum ist das so wichtig? Viele Erzieherinnen und Erzieher erleben diesen Moment - aber nur wenige dokumentieren ihn richtig. Beobachtung und Dokumentation in der Elementarpädagogik sind nicht bloß bürokratische Pflichten. Sie sind das Herzstück jeder pädagogischen Arbeit. Denn nur wer genau hinschaut, kann wirklich sehen, wie ein Kind lernt - nicht wie es sich verhalten sollte, sondern wie es wirklich ist.
Warum Beobachtung mehr ist als Notizen machen
Beobachtung in der Kita hat nichts mit Kontrolle zu tun. Es geht nicht darum, zu prüfen, ob ein Kind den Entwicklungsstand erreicht hat. Es geht darum, den Weg zu verstehen. Ein Kind, das ständig im Spielbereich mit Bausteinen bleibt, könnte als „nur im Konstruktionsbereich aktiv“ abgehakt werden. Aber was, wenn es gerade lernt, wie man Stabilität erreicht? Was, wenn es zum ersten Mal ohne Hilfe einen Turm baut, der nicht umfällt? Das ist kein Zufall. Das ist Lernen. Und das muss sichtbar werden. Der Sächsische Bildungsplan von 2007 sagt klar: Der Blick auf das Kind muss wohlwollend und ermutigend sein. Es geht nicht um Defizite, sondern um Stärken. Wer nur nach Lücken sucht, sieht die Entwicklung nicht. Wer aber nach Anzeichen von Neugier, Ausdauer oder sozialer Initiative sucht, entdeckt, was das Kind wirklich kann - und was es als nächstes braucht.Portfolio: Die Lerngeschichte des Kindes
Ein Portfolio ist kein Ordner mit Fotos und Stempeln. Es ist die Geschichte eines Kindes, erzählt durch seine Arbeiten, seine Worte, seine Momente. Ein Bild von einem Kind, das mit Farben experimentiert. Ein Zitat aus einem Gespräch: „Ich hab’s geschafft, weil ich nicht aufgegeben hab.“ Ein Elternbrief, der sagt: „Zu Hause spricht es jetzt viel mehr über die Kita.“ Die Universität Bremen betont: Ein Portfolio dient nicht nur der Kita, sondern auch der Grundschule. Es wird zur Brücke. Wenn eine Lehrerin am ersten Schultag sieht, dass ein Kind schon mit Komplexität umgehen kann - nicht weil es Buchstaben kann, sondern weil es aus eigenen Erfahrungen erzählen kann - dann verändert das den ganzen Unterricht. Ein gutes Portfolio ist individuell. Es enthält nicht alles. Es enthält nur das, was authentisch ist. Es zeigt nicht, was das Kind „könnte“, sondern was es wirklich getan hat. Und es zeigt, wie es sich verändert hat. Ein Kind, das am Anfang des Jahres nur alleine spielte und am Ende eine Gruppe anleitet? Das ist kein Zufall. Das ist Entwicklung. Und das muss sichtbar sein.Entwicklungspläne: Von Beobachtung zur Handlung
Beobachtung allein reicht nicht. Wenn man sieht, dass ein Kind Schwierigkeiten hat, mit anderen zu teilen, dann muss man darauf reagieren. Ein Entwicklungsplan macht das möglich. Er ist kein Prüfungsprotokoll. Er ist ein Werkzeug für die pädagogische Arbeit. Er besteht aus drei Teilen: Was haben wir beobachtet? Was braucht das Kind? Was machen wir jetzt? Die Kindergartenakademie (2023) hat in einer Umfrage festgestellt: Nur 35 % der dokumentierten Beobachtungen sind so gut, dass sie wirklich zur Planung dienen. Warum? Weil viele Beobachtungen zu oberflächlich sind. Zu allgemein. Zu schnell aufgeschrieben. Ein guter Entwicklungsplan formuliert konkret: „Liam zeigt Interesse am Sprachspiel, aber vermeidet Gruppenaktivitäten. Wir bieten ihm wöchentlich ein kleines Sprachtheater mit maximal drei Kindern an, um sein Vertrauen zu stärken.“ Das ist kein Vorsatz. Das ist eine Maßnahme. Und sie wird dokumentiert - nicht für die Aufsicht, sondern für das Kind.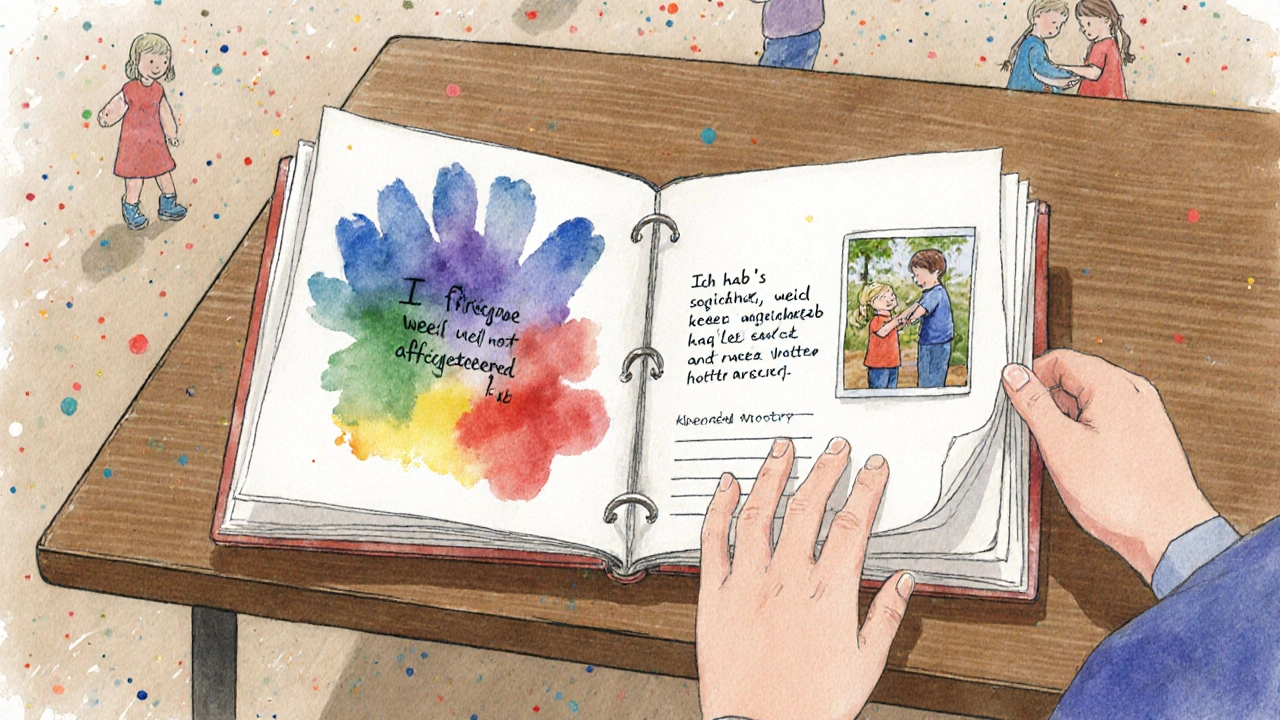
Offene vs. strukturierte Beobachtung: Was passt wann?
Nicht jede Beobachtung muss gleich sein. Es gibt zwei Hauptwege: offene und strukturierte Beobachtung. Offene Beobachtung bedeutet: Du schreibst auf, was du siehst - ohne vorgegebene Kategorien. Du beschreibst, wie das Kind die Schere hält, wie es den Blickkontakt sucht, wie es lacht, wenn jemand etwas Neues sagt. Diese Methode ist ideal, um die Individualität zu erfassen. Sie ist besonders nützlich, wenn du ein Kind zum ersten Mal beobachtest oder wenn du merkst, dass es etwas Besonderes tut. Strukturierte Beobachtung hingegen nutzt Fragebögen oder Checklisten. Sie fragt: Hat das Kind heute drei Mal mit anderen Kindern gespielt? Hat es die Farbe Rot benannt? Hat es einen Satz mit zwei Wörtern gebildet? Diese Methode ist nützlich, um Entwicklungsstände zu vergleichen - etwa über den Jahresverlauf hinweg oder zwischen Kindern. Die Landesregierung Steiermark (2017) empfiehlt: Kombiniere beide. Nutze offene Beobachtung, um das Kind zu verstehen. Nutze strukturierte Bögen, um die pädagogische Arbeit zu planen. So bekommst du das Beste aus beiden Welten: Tiefe und Übersicht.Die Kurzzeitbeobachtung: Weniger ist mehr
Die Kurzzeitbeobachtung ist eine der wirksamsten Methoden. Sie stammt aus Reggio Emilia, wurde aber von Hans Rudolf Leu vom Deutschen Jugendinstitut für Deutschland übernommen. Und sie ist einfach: Jedes Kind wird mindestens zweimal im Jahr für fünf bis zehn Minuten beobachtet. In dieser Zeit schreibst du nur auf, was du siehst - ohne zu interpretieren, ohne zu bewerten. Warum funktioniert das? Weil es spontan ist. Weil du nicht nach einem „richtigen“ Verhalten suchst. Weil du nicht vorher denkst: „Das ist jetzt ein sozialer Moment.“ Du beobachtest einfach. Und oft entdeckst du Dinge, die du sonst übersehen hättest: Ein Kind, das anderen hilft, ohne dass es jemand gebeten hat. Ein Kind, das sich selbst beruhigt, indem es einen Stein in der Hand hält. Wichtig: Die Beobachtung muss sofort nach dem Moment aufgeschrieben werden. Keine halbe Stunde später. Kein „mache ich später“. Sonst vermischt du deine Erinnerung mit deinen Annahmen. Und dann ist es keine Beobachtung mehr - sondern eine Geschichte, die du dir selbst erzählst.Praxis-Herausforderungen: Zeit, Struktur, Teamarbeit
Die Realität sieht anders aus. In einer Umfrage der Kindergartenakademie (2023) gaben 68 % der Erzieherinnen und Erzieher an, nicht genug Zeit für qualitativ hochwertige Dokumentation zu haben. 42 % sagten, sie hätten keine strukturierten Methoden. Das ist kein Mangel an Motivation. Das ist ein Systemproblem. Dokumentation funktioniert nur, wenn sie Teil des Alltags ist. Wenn sie nicht als „Zusatzarbeit“ gilt, sondern als pädagogisches Handwerkszeug. Und sie funktioniert nur, wenn das Team zusammenarbeitet. Ein einzelner Erzieher kann nicht alles dokumentieren. Aber ein Team, das sich regelmäßig austauscht, kann Beobachtungen validieren. „Hast du das auch gesehen?“ „Ich dachte, das war nur ein Zufall.“ „Nein, das hat sie jetzt zum dritten Mal gemacht.“ Die Kita „Regenbogen“ in Stuttgart hat das vorgemacht. Durch konsequente Portfolioarbeit und regelmäßige Teamgespräche konnten sie die elterliche Beteiligung um 57 % steigern und die Übergangsprobleme in die Grundschule um 43 % reduzieren. Es war kein teures Programm. Es war eine klare Haltung: Wir sehen die Kinder. Wir schreiben auf, was sie tun. Und wir handeln danach.
Digitalisierung: Hilfsmittel - nicht Ersatz
Digitale Tools gibt es viele: Apps, Tablets, Cloud-Systeme. Sie können helfen. Aber sie dürfen nicht die Beziehung ersetzen. Der Sächsische Bildungsplan (2022) warnt: Digitale Dokumentation darf nicht dazu führen, dass Erzieherinnen und Erzieher ständig auf den Bildschirm schauen, statt auf die Kinder. Ein Tablet kann ein Foto speichern. Aber es kann nicht fühlen, ob ein Kind traurig ist, weil es allein ist. Ein Programm kann eine Checkliste abhaken. Aber es kann nicht wissen, warum ein Kind plötzlich nicht mehr mit jemandem spielt. Digitale Tools sind sinnvoll, wenn sie die Arbeit erleichtern - nicht wenn sie sie komplizierter machen. Ein guter Ansatz: Nutze digitale Bögen für strukturierte Beobachtungen. Nutze Papierportfolios für die persönlichen Geschichten. Und halte immer Zeit frei - für das Kind, nicht für das Formular.Die Zukunft: Kinder als Mitgestalter
Die größte Veränderung kommt von unten. Kinder werden immer mehr in den Dokumentationsprozess einbezogen. Die Universität Bremen (2023) forscht dazu: Kinder wählen aus, was sie in ihr Portfolio legen wollen. Sie malen, was sie gelernt haben. Sie erzählen, was sie besonders stolz finden. Das ist keine pädagogische Mode. Das ist Respekt. Wenn ein Kind entscheiden darf, was über es geschrieben wird, dann lernt es, sich selbst wahrzunehmen. Dann lernt es, seine Entwicklung zu verstehen. Dann wird Dokumentation nicht zu etwas, das andere über es machen - sondern zu etwas, das es mit macht.Was bleibt: Der Blick auf das Kind
Beobachtung und Dokumentation in der Elementarpädagogik sind kein Ziel. Sie sind ein Mittel. Das Ziel ist das Kind. Die Frage ist nicht: „Haben wir alles dokumentiert?“ Die Frage ist: „Haben wir das Kind gesehen?“ Wenn du am Ende des Tages nur ein einziges Mal wirklich gesehen hast, wie ein Kind etwas Neues entdeckt hat - dann hast du deine Aufgabe erfüllt. Und dann hast du auch alles dokumentiert, was zählt.Warum ist Portfolioarbeit in der Kita wichtig?
Ein Portfolio dokumentiert die individuelle Lerngeschichte eines Kindes - nicht nur seine Fähigkeiten, sondern auch seine Interessen, seine Entwicklungsfortschritte und seine persönlichen Momente. Es dient als Brücke zur Grundschule, ermöglicht Elterngespräche mit konkreten Beispielen und hilft Erzieherinnen, gezielte pädagogische Angebote zu planen. Im Gegensatz zu Testergebnissen zeigt es, wie ein Kind lernt - nicht nur was es kann.
Was ist der Unterschied zwischen Beobachtung und Diagnostik?
Beobachtung in der Elementarpädagogik betrachtet alle Kinder im Alltag und sucht nach Entwicklungsprozessen, Stärken und Lernwegen. Diagnostik hingegen richtet sich auf spezifische Auffälligkeiten oder Entwicklungsverzögerungen und wird meist von Fachkräften wie Psychologen oder Sprachtherapeuten durchgeführt. Beobachtung ist für alle Kinder - Diagnostik ist für einzelne, bei Bedarf.
Wie oft sollte ein Kind beobachtet werden?
Mindestens zweimal pro Jahr sollte jedes Kind durch eine Kurzzeitbeobachtung erfasst werden - jeweils 5 bis 10 Minuten, direkt und ohne Vorbereitung. Zusätzlich sollten kontinuierliche, informelle Beobachtungen im Alltag stattfinden. Wichtig ist nicht die Häufigkeit, sondern die Qualität: Ein sorgfältig dokumentierter Moment ist wertvoller als zehn flüchtige Notizen.
Wie kann man Beobachtungsbögen sinnvoll nutzen?
Beobachtungsbögen helfen, systematisch zu erfassen - aber sie dürfen nicht zum Zwang werden. Nutze sie für strukturierte Aspekte wie Sprachentwicklung oder Motorik. Kombiniere sie mit offenen Notizen, um den Kontext zu erfassen. Und immer: Sprich mit Kolleginnen darüber. Nur so vermeidest du eigene Vorurteile und siehst das Kind wirklich.
Was tun, wenn man keine Zeit für Dokumentation hat?
Dokumentation muss nicht alles sein. Beginne klein: Beobachte ein Kind pro Tag für fünf Minuten. Schreibe nur drei Sätze auf. Teile sie mit einer Kollegin. Nutze digitale Tools, die automatisch Fotos oder Audios speichern. Wichtig ist: Mach es zur Routine, nicht zur Last. Ein Team, das sich täglich 15 Minuten Zeit nimmt, um zu sprechen, was sie gesehen haben, schafft mehr als ein einzelner, überlasteter Erzieher mit 20 Seiten Papier.


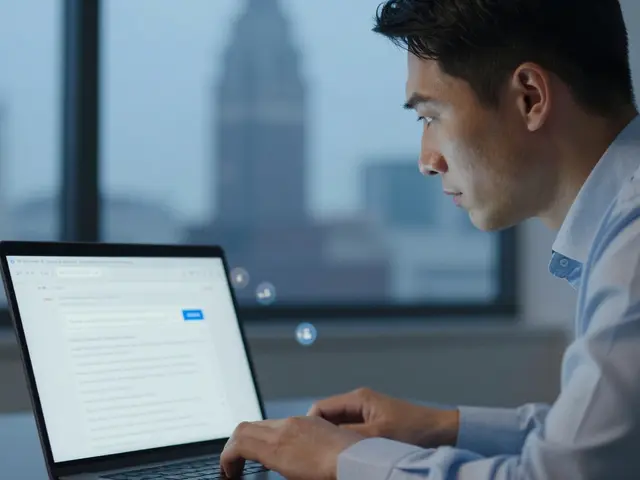




10 Kommentare
Runa Kalypso
ich hab das mit dem portfolio auch so gemacht, aber meine kollegin hat es dann als "unnötige bürokratie" abgetan. jetzt hab ich keine zeit mehr, weil ich ständig nachlegen muss. ich meine, wer soll das alles lesen? 🤷♀️
Astrid Shapiro
Das ist ein klassisches Beispiel für pädagogische Oberflächlichkeit. Die Dokumentation wird als administrativer Aufwand missverstanden, obwohl sie die essentielle Brücke zwischen Beobachtung und Intervention bildet. Ohne kontextuelle, individuelle Protokollierung reduziert sich pädagogische Arbeit auf eine reine Verhaltenskontrolle – und das ist kein Bildungsprozess, das ist Sozialmanagement.
Die sächsische Bildungsrichtlinie von 2007 wurde nicht für den Papierkorb entwickelt. Sie ist ein ethischer Rahmen. Wer sie ignoriert, ignoriert die Kinder. Und wer das nicht sieht, hat keinen Platz in der Elementarpädagogik.
Es geht nicht um die Anzahl der Fotos oder die Perfektion der Bögen. Es geht um die Authentizität des Moments. Ein Kind, das einen Turm baut, der nicht umfällt – das ist kein Zufall, das ist kognitive Entwicklung in Echtzeit. Und wer das nicht dokumentiert, hat nicht beobachtet. Er hat nur zugesehen.
Die Universität Bremen hat es bewiesen: Portfolios verändern den Übergang zur Grundschule. Lehrerinnen sehen nicht nur die Testergebnisse, sie sehen die Geschichte. Und das macht den Unterschied zwischen "das Kind kann nicht lesen" und "das Kind hat gelernt, durch Ausdauer zu lernen".
Ich habe in meiner Kita ein System eingeführt, bei dem jede Beobachtung innerhalb von 15 Minuten nach dem Ereignis aufgeschrieben wird. Keine Ausreden. Keine "mache ich später". Und wissen Sie was? Die Kollegen haben angefangen, sich gegenseitig zu ergänzen. Die Qualität der Dokumentation hat sich verdreifacht. Die Eltern haben begonnen, aktiv mitzuschreiben. Die Kinder haben angefangen, ihre eigenen Portfolios zu wählen.
Das ist kein Wunder. Das ist Konsequenz. Und wer das nicht versteht, hat die pädagogische Grundlage nie verstanden. Es geht nicht um Dokumentation als Pflicht. Es geht um Dokumentation als Anerkennung.
Wenn ein Kind sagt: "Ich hab’s geschafft, weil ich nicht aufgegeben hab", dann ist das mehr wert als alle standardisierten Tests der Welt. Und wer das nicht aufschreibt, hat das Kind nicht gesehen. Er hat nur eine Aufgabe erledigt.
Ich habe in der letzten Woche ein Portfolio mit einem Kind durchgearbeitet. Es war sieben Jahre alt, hatte Sprachförderbedarf und war bis dahin still und zurückhaltend. Am Ende des Jahres hat es vor der ganzen Gruppe ein Gedicht vorgelesen. Ich habe das aufgenommen. In der Kita haben wir es als Audio-Datei ins Portfolio eingefügt. Die Eltern haben geweint. Die Lehrerin der Grundschule hat es in der Einschulungsbesprechung vorgelesen. Das Kind hat sich verändert. Nicht weil wir es trainiert haben. Sondern weil wir es gesehen haben.
Dokumentation ist keine Bürokratie. Sie ist die sichtbare Form von Respekt.
Catharina Doria
Die Kurzzeitbeobachtung nach Leu ist die einzige Methode, die tatsächlich valide ist. Alles andere ist theatralische Selbsttäuschung. Ich hab in meiner Kita eine 8-Minuten-Beobachtungs-Protokoll-App implementiert – mit Zeitstempel, GPS-Tagging und automatischer Kategorisierung nach den 7 Dimensionen des sächsischen Bildungsplans. Die Daten sind jetzt quantifizierbar, vergleichbar, auditierbar. Und das ist der einzige Weg, um systemische Defizite zu identifizieren.
Die 68% der Erzieher, die angeben, keine Zeit zu haben – die haben einfach keine Struktur. Das ist kein Problem der Arbeitsbelastung, das ist ein Problem der Kompetenz. Wer nicht in der Lage ist, 10 Minuten pro Tag für eine fokussierte Beobachtung aufzubringen, hat keinen Anspruch auf den Berufstitel "Erzieher".
Und digital? Natürlich nutzen wir Tablets. Aber nicht, weil es trendy ist. Sondern weil Papier verloren geht. Weil Notizen verfälscht werden. Weil Erinnerungen verzerrt sind. Die digitale Dokumentation ist kein Ersatz für den Blick – sie ist die Erweiterung des Blicks. Mit OCR, Bildanalyse und Spracherkennung können wir Muster erkennen, die ein menschliches Auge nie sieht. Ein Kind, das jeden Mittwoch um 10:17 Uhr den Stein in der Hand hält? Das ist kein Zufall. Das ist Regulation. Und das hat kein Kollege jemals bemerkt – bis wir die Daten ausgewertet haben.
Wenn Sie nicht digital dokumentieren, dokumentieren Sie nicht. Punkt.
Herbert Finkernagel
Die ganze Diskussion ist ein Mythos. Beobachtung ist keine Wissenschaft, sie ist eine subjektive Interpretation, verpackt in pädagogischen Jargon. Wer sagt, dass der Turm aus sieben Klötzen "Lernen" ist? Vielleicht hat das Kind nur keine anderen Spielzeuge. Vielleicht hat es Angst vor anderen Kindern. Vielleicht ist es einfach nur faul. Sie projizieren Bedeutung hinein, wo keine ist. Das ist keine Pädagogik, das ist Selbstbetrug.
Und dann kommen diese Portfolios – als ob ein Kind etwas versteht, was ein 40-jähriger Erzieher nicht mal versteht. Die Kinder werden zu Objekten einer künstlichen Biografie. Das ist keine Respekt, das ist Kontrolle unter dem Deckmantel der Individualität.
Ich hab 20 Jahre in Kitas gearbeitet. Die meisten Beobachtungen sind nach drei Monaten vergessen. Die Kinder entwickeln sich trotzdem. Ohne Papier. Ohne Apps. Ohne Portfolio. Nur weil sie Kinder sind. Und weil sie leben.
Timon Ostertun
warum muss das alles so kompliziert sein ich hab ne kiste mit klötzen gesehen und ein kind hat nen turm gebaut und dann hat es gelacht das wars doch schon
Julia Wooster
Ich habe diese Diskussion schon hundert Mal erlebt. Diejenigen, die die Dokumentation als "Herzstück" bezeichnen, sind meist dieselben, die am Ende des Jahres 47 Seiten Papier abliefern, die niemand liest. Die Eltern? Sie wollen wissen, ob ihr Kind glücklich ist. Die Lehrer? Sie wollen wissen, ob es sich anpassen kann. Und was bekommen sie? Eine Sammlung von Fotos mit unverständlichen Kommentaren wie "soziale Initiative in Kontext der kognitiven Entwicklung".
Ich habe eine Kollegin, die jedes Kind mit einem iPad filmte – 10 Minuten pro Tag. Dann hat sie die Videos mit KI analysieren lassen. Die KI hat festgestellt: 87% der "sozialen Interaktionen" waren tatsächlich nur Fluchtverhalten. Die Kinder haben sich nicht verbunden – sie haben sich voneinander abgewendet, aber mit einem Lächeln, damit die Erzieherin nicht merkt, dass sie allein sind.
Dokumentation ist kein Werkzeug der Erkenntnis. Sie ist ein Werkzeug der Legitimation. Für die Leitung. Für die Aufsichtsbehörde. Für die Eltern, die glauben, sie hätten etwas "gefördert". Aber nicht für das Kind.
Das Kind braucht keinen Ordner. Es braucht jemanden, der da ist. Und der nicht ständig auf sein Handy schaut, während es versucht, einen Turm zu bauen.
Niklas Lindgren
Deutschland ist so bescheuert. Wir machen aus einem Kind, das einen Turm baut, eine wissenschaftliche Studie. Und dann wundern wir uns, warum die Kinder nicht mehr spielen können. Ich hab als Kind auch Türme gebaut – mit Holzklötzen, aus dem Garten. Kein Portfolio. Kein Tablet. Kein "Entwicklungsplan". Ich hab einfach gebaut. Und dann ist er umgefallen. Und ich hab wieder angefangen. Und das war’s. Kein Mensch hat es dokumentiert. Und ich hab trotzdem gelernt.
Heute ist alles ein Projekt. Ein Konzept. Eine KPI. Ein "individueller Lernpfad". Aber wer hat eigentlich noch Zeit, einfach nur zuzuschauen? Wer hat noch den Mut, zu sagen: "Das Kind ist jetzt einfach nur ein Kind."
Wir haben die Pädagogik kaputt gemacht. Mit Papier, mit Apps, mit Checklisten. Und jetzt wundern wir uns, dass die Kinder nicht mehr lernen – weil sie nicht mehr spielen dürfen. Weil alles dokumentiert werden muss. Weil jeder Moment zu einem "Lernmoment" werden muss.
Ich hab ne Tochter. Sie ist drei. Sie baut Türme. Und ich lache. Und das ist mehr wert als alle Portfolios der Welt.
Markus Paul
Beobachtung ist kein Instrument. Sie ist eine Haltung. Und wer sie als Methode begreift, hat sie verfehlt.
Stefanie Barigand
Das ist der Untergang der deutschen Bildung. Wir verwandeln Kinder in Datenpunkte. Wir dokumentieren ihre Emotionen, ihre Spielverhalten, ihre Stimmungen – als ob sie Maschinen wären. Und dann sagen wir, wir fördern sie. Aber wer hat jemals nachgefragt, ob das Kind das will? Ob es sich gesehen fühlt – oder nur ausgebeutet? Die Eltern bekommen Berichte, die sie nicht verstehen. Die Lehrer bekommen Vorgaben, die sie nicht einhalten können. Und die Kinder? Die lernen, dass sie nur wertvoll sind, wenn sie dokumentiert werden. Das ist keine Pädagogik. Das ist Überwachung mit Kinderschuhen.
Und dann kommt noch die Digitalisierung. Tablets. Apps. KI-Analysen. Wir schauen nicht mehr auf die Kinder. Wir schauen auf Bildschirme. Wir bewerten nicht mehr das Kind – wir bewerten die Datei. Und das ist der tiefste Verrat an der Pädagogik, den ich je gesehen habe.
Wir haben die Seele aus der Kita verbannt. Und jetzt wundern wir uns, warum die Kinder so traurig sind.
Astrid Shapiro
Das ist genau der Punkt, den Herbert Finkernagel übersehen hat. Dokumentation ist nicht das Gegenteil von Spiel. Sie ist die Erweiterung von Spiel. Wenn ein Kind einen Turm baut, und du ihn aufschreibst – dann sagst du ihm: "Ich habe dich gesehen. Dein Moment zählt." Das ist kein Druck. Das ist Zugehörigkeit.
Ich habe ein Kind, das nie mit anderen gesprochen hat. Bis zu dem Tag, an dem es einen Turm gebaut hat, der umfiel. Ich habe aufgeschrieben: "Lukas hat den Turm gebaut. Er hat gelacht, als er umfiel. Er hat gesagt: "Mach nochmal!" – und hat es gemacht. Dreimal. Ohne Hilfe."
Ein Monat später hat er mit einem anderen Kind gesprochen. Nicht, weil wir es trainiert haben. Sondern weil er wusste: Was er tut, ist wichtig. Weil jemand es gesehen hat.
Dokumentation ist kein Werkzeug der Kontrolle. Sie ist ein Akt der Liebe. Und wer das nicht versteht, hat nie ein Kind wirklich gesehen.