Stell dir vor, dein Forschungsprojekt in Graz bekommt Geld aus Brüssel - nicht nur ein paar Tausend Euro, sondern Millionen. Und nicht allein, sondern zusammen mit Partnern aus Finnland, Spanien und der Ukraine. Das ist nicht Science-Fiction. Das ist Horizon Europe, das größte Forschungsprogramm der Europäischen Union aller Zeiten. Und Österreich ist mitten drin - nicht als Zuschauer, sondern als aktiver Akteur mit echtem Einfluss.
Was ist Horizon Europe wirklich?
Horizon Europe läuft von 2021 bis 2027 und hat ein Budget von 95,5 Milliarden Euro. Das ist mehr als das gesamte österreichische Bildungsbudget für zehn Jahre. Es geht nicht um kleine Stipendien, sondern um große, gemeinsame Projekte, die echte Probleme lösen: Krebs bekämpfen, Städte klimaneutral machen, neue Materialien für die Industrie entwickeln. Das Programm ist in drei Säulen aufgebaut: Wissenschaftliche Exzellenz, globale Herausforderungen und Innovatives Europa. Dazu kommen Querschnittsthemen wie Digitalisierung, Klimaschutz und Geschlechtergerechtigkeit - alles miteinander verknüpft.
Was viele nicht wissen: Horizon Europe ist kein einfaches Förderprogramm. Es ist ein Netzwerk. Wer hier mitmacht, arbeitet nicht nur mit Kollegen aus anderen Ländern, sondern nutzt deren Expertise, Infrastruktur und Märkte. Das ist der große Vorteil gegenüber rein nationalen Programmen. Ein österreichisches Startup kann mit einer Universität in Polen und einem Forschungsinstitut in Portugal ein Projekt einreichen - und damit viel mehr erreichen, als es allein könnte.
Wie beteiligt sich Österreich?
Österreich ist dabei - und zwar richtig. Laut einem Parlamentsdokument vom März 2025 nimmt das Land an 25 von 28 Europäischen Partnerschaften innerhalb von Horizon Europe teil. Das ist mehr als fast alle anderen Mitgliedstaaten. Die Koordination läuft über das Bundesministerium für Klimaschutz (BMK), die FFG und den FWF. Diese Stellen sind nicht nur Administratoren, sie helfen auch: mit Beratung, Schulungen und Netzwerken.
Die Zahlen sprechen für sich: Im Jahr 2024 haben österreichische Einrichtungen insgesamt 487,2 Millionen Euro aus Horizon Europe bekommen - ein Sprung von 14,3 % gegenüber 2023. Das ist nicht nur Geld, das ist Sichtbarkeit. Die Medizinische Universität Wien allein holte über 128 Millionen Euro aus dem Vorgängerprogramm Horizon 2020. Die TU Wien kam auf 89 Millionen. Das sind nicht nur Projekte, das sind Jobs, neue Labore, internationale Kooperationen.
Und Österreich ist auch bei den Spitzenreitern: Pro Kopf steht das Land auf Platz 4 in der EU - mit 278 Euro Förderung pro Einwohner. Das bedeutet: Wir nutzen das Programm effizient. Aber es gibt auch eine Kehrseite: Während große Universitäten gut abschneiden, bleiben viele kleine Institute und KMUs hinterher. Die Universität für Bodenkultur Wien hatte 2022 nur eine Erfolgsquote von 8,3 % bei ERC-Grants - ein deutliches Signal, dass nicht alle gleich gut vorbereitet sind.
Was wird gerade gefördert? Die aktuellen Schwerpunkte 2025
Das Jahr 2025 ist ein Wendepunkt. Im März wurde ein neuer Strategieplan für 2025-2027 vorgestellt - und er ist klar: Technologische Souveränität. Das heißt: Wir wollen weniger abhängig sein von Importen. Dafür gibt es drei neue Europäische Partnerschaften: für fortgeschrittene Werkstoffe, Textilien und Photovoltaik. Kein Zufall: Das sind Bereiche, in denen Europa bisher hinterherhinkt. Österreichische Unternehmen wie voestalpine sind dabei und berichten von einer 23 % höheren Innovationsrate durch diese Partnerschaften.
Aber es geht nicht nur um Technik. Die sogenannten Missions sind das Herzstück von Horizon Europe. Fünf konkrete Ziele, die bis 2030 erreicht werden sollen. Eine davon: 100 europäische Städte sollen klimaneutral sein. Und guess what? Linz und Graz sind dabei. Sie sind Pilotstädte. Das heißt: Sie bekommen Geld, um ihre Energieversorgung umzubauen, ihre Verkehrssysteme zu modernisieren, ihre Gebäude zu sanieren - und das alles im Verbund mit anderen Städten. Das ist keine Theorie. Das passiert jetzt.
Ein weiteres Mission-Projekt: Krebs bekämpfen. Hier gibt es konkrete Ausschreibungen, wie HORIZON-MISS-2025-CANCER-02-02, die untersucht, wie Umweltgifte das Krebsrisiko bei Kindern erhöhen. Die Einreichungsfrist ist der 16. September 2025. Wer hier mitmacht, hat direkten Einfluss auf zukünftige Gesundheitspolitik - und das nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa.

Die Hürden: Warum viele scheitern
Es ist kein Zuckerschlecken. Die Erfolgsquote für ERC Starting Grants 2023 lag bei nur 12,7 %. Das heißt: Von zehn Anträgen wird nur einer genehmigt. Und das liegt nicht nur an der Qualität, sondern an der Komplexität. Die Anträge sind lang, bürokratisch, voller Vorgaben. Ein Startup aus Tirol, CellFate, schreibt auf Reddit: „Wir brauchen 380 Arbeitsstunden pro Antrag. Für ein Team mit 15 Leuten ist das unmöglich.“
Die größten Hindernisse? Erstens: Die Konsortialbildung. 78 % der österreichischen Forschungseinrichtungen nennen das als größtes Problem. Wer findet die richtigen Partner? Wer versteht die rechtlichen Rahmenbedingungen? Wer kümmert sich um die Finanzen? Zweitens: Die Berichterstattung. Nach dem Projekt muss man dokumentieren - und zwar detailliert. Wer das nicht kann, verliert den Rest des Geldes.
Und dann ist da noch die ungleiche Verteilung. Die Gesundheitsforschung bekommt 28,7 % der österreichischen Fördermittel, die Klimaforschung 22,4 %. Aber die Kultur- und Kreativwirtschaft? Nur 3,2 %. Das ist kein Fehler, das ist eine Entscheidung. Und sie trifft viele, die gar nicht auf der Liste stehen.
Wie kann man erfolgreich sein? Tipps aus Österreich
Die gute Nachricht: Es gibt Wege, die Hürden zu überwinden. Und die meisten davon sind in Österreich verfügbar. Die FFG-Akademie bietet Schulungen wie „Come on Board: Basiswissen für Newcomer“ an - mit durchschnittlich 45 Teilnehmern pro Kurs. Wer dort hingeht, lernt, wie man einen Antrag strukturiert, wie man Partner findet, wie man die Finanzen plant.
Der wichtigste Tipp: Kontaktiere die Nationalen Kontaktstellen Österreich (NKP). Sie bieten monatliche Info-Veranstaltungen an - und kommen zu den Leuten. 120 Personen pro Event - das ist kein Zufall. Wer die NKP früh einbindet, steigert seine Erfolgsquote um 18,7 %. Das ist kein kleiner Sprung. Das ist der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg.
Ein weiterer Tipp: Starte klein. Ein Pilotprojekt mit zwei Partnern, nicht mit zehn. Mach dir klar: Horizon Europe ist kein Wettbewerb, sondern ein Lernprozess. Die ersten Anträge sind oft ein Experiment. Die zweiten sind schon besser. Die dritten? Die sind erfolgreich.

Was kommt als Nächstes?
Horizon Europe ist kein Endpunkt. Es ist der Anfang. Der nächste Schritt ist Horizon Europe 2.0 - für die Jahre 2028 bis 2034. Das Budget soll auf 116,5 Milliarden Euro steigen. Das bedeutet: Die Möglichkeiten werden größer. Und die Prioritäten werden sich weiter verändern. Im zweiten Quartal 2025 soll eine neue „Europäische Partnerschaft für virtuelle Welten“ starten - ein Bereich, in dem Österreich mit seinen Stärken in Software und KI eine wichtige Rolle spielen könnte.
Auch die EU-Quantenstrategie, die im Frühjahr 2025 verabschiedet wird, wird Österreich stärken. Die TU Wien, die Uni Innsbruck und das Austrian Institute of Technology haben bereits Quantenlabore aufgebaut. Mit Horizon Europe können sie jetzt diese Technologien europaweit skalieren - und nicht nur für Österreich, sondern für ganz Europa.
Die Kritik bleibt: Die Grundlagenforschung in den Geistes- und Sozialwissenschaften bekommt nur 2,8 % des Budgets von Pfeiler 2. Das ist zu wenig. Aber die Realität ist: Wer heute in Europa Forschung macht, muss sich an den Prioritäten orientieren - und das sind Klima, Gesundheit, Digitalisierung, Souveränität. Wer das versteht, findet seinen Platz. Wer dagegen argumentiert, bleibt außen vor.
Was bedeutet das für dich?
Wenn du in Österreich forscht - egal ob an einer Uni, in einem Startup oder in einem Forschungsinstitut - dann ist Horizon Europe dein größtes Instrument. Es ist nicht nur Geld. Es ist Zugang. Es ist Netzwerk. Es ist Sichtbarkeit. Es ist die Chance, deine Arbeit nicht nur lokal, sondern europaweit zu verändern.
Und wenn du noch nicht dabei bist? Dann fang jetzt an. Melde dich bei der NKP. Geh zu einer Schulung. Lies die Ausschreibungen. Sprich mit Kollegen, die schon dabei waren. Die Zeit läuft. Die Fristen kommen schnell. Und die nächste Chance, die deine Forschung verändert, ist vielleicht nur ein Antrag entfernt.
Was ist Horizon Europe genau?
Horizon Europe ist das größte Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen Union (2021-2027) mit einem Budget von 95,5 Milliarden Euro. Es fördert wissenschaftliche Exzellenz, löst gesellschaftliche Herausforderungen wie Klimawandel und Krebs und stärkt die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas. Österreich ist aktiv mit dabei - über das BMK, die FFG und den FWF.
Wie viel Geld bekommt Österreich aus Horizon Europe?
Im Jahr 2024 erhielten österreichische Forschungseinrichtungen insgesamt 487,2 Millionen Euro aus Horizon Europe - ein Anstieg von 14,3 % gegenüber 2023. Pro Kopf liegt Österreich mit 278 Euro auf Platz 4 in der EU, was die hohe Effizienz der österreichischen Forschungslandschaft zeigt.
Welche österreichischen Institutionen sind besonders erfolgreich?
Die Medizinische Universität Wien (128 Mio. € aus Horizon 2020) und die TU Wien (89 Mio. €) gehören zu den erfolgreichsten. Auch voestalpine und andere Großunternehmen profitieren stark. Kleinere Universitäten wie die BOKU Wien haben dagegen niedrigere Erfolgsquoten - ein Hinweis auf strukturelle Unterschiede in der Vorbereitung.
Warum scheitern viele Anträge?
Die Hauptgründe sind die komplexe Konsortialbildung (78 % der Befragten nennen das als größtes Hindernis), die hohe administrative Belastung (380 Stunden pro Antrag für kleine Teams) und die strenge Berichterstattung. Die Erfolgsquote liegt bei durchschnittlich 12,7 %, was zeigt, wie hoch der Wettbewerb ist.
Wie kann ich als österreichische Forscherin oder Forscher starten?
Melde dich bei den Nationalen Kontaktstellen Österreich (NKP). Sie bieten kostenlose Schulungen wie „Come on Board“ an und helfen bei der Antragsvorbereitung. Beginne mit einem kleinen Projekt, baue ein starkes Konsortium auf und nutze die Unterstützung der NKP - das erhöht deine Erfolgsquote um bis zu 18,7 %.
Gibt es neue Förderschwerpunkte 2025?
Ja. Im März 2025 wurden drei neue Europäische Partnerschaften gestartet: für fortgeschrittene Werkstoffe, Textilien und Photovoltaik - mit dem Ziel, technologische Souveränität zu stärken. Außerdem läuft die EU-Mission gegen Krebs weiter, mit konkreten Ausschreibungen wie HORIZON-MISS-2025-CANCER-02-02, die Umweltgifte bei Kindern untersucht.
Warum ist Graz dabei?
Graz ist eine der 87 europäischen Städte, die in die EU-Mission „100 klimaneutrale und intelligente Städte“ aufgenommen wurden. Das bedeutet: Die Stadt erhält EU-Mittel, um ihre Energieversorgung, Mobilität und Gebäude nachhaltig umzubauen - und arbeitet dabei mit anderen Pilotstädten wie Linz, Barcelona oder Helsinki zusammen.
Welche Rolle spielen KMUs in Horizon Europe?
KMUs sind unterrepräsentiert: Sie machen nur 18,7 % der österreichischen Teilnehmer aus. Viele klagen über zu hohe administrative Lasten. Die EU plant daher bis Ende 2025 neue Maßnahmen, um KMUs besser zu unterstützen - etwa durch vereinfachte Anträge und spezielle Förderlinien.





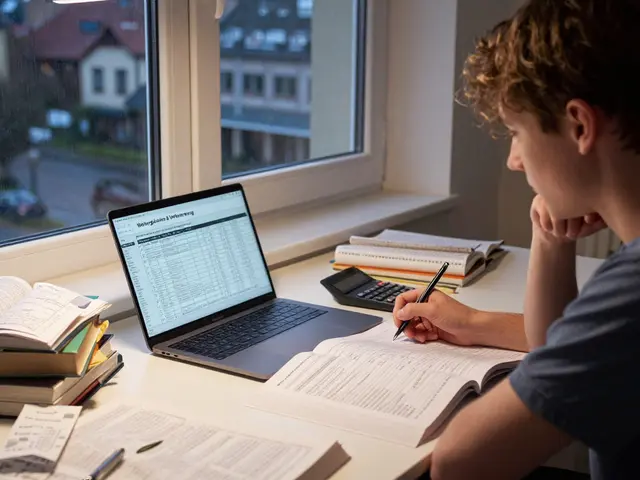

14 Kommentare
Stephan Lepage
horizon europe is sooo 2020 ich mein wer hat noch zeit für so viel bürokratie die leute in den labs sterben doch nur vor stress
Erica Schwarz
ich find's toll, dass endlich mehr für klimaneutrale städte fließt. graz und linz haben echt was vorangetrieben, das sollte man mehr feiern als nur in bürokratischen reports
Harry Hausverstand
die 380 stunden pro antrag sind kein mythos, das hab ich selbst durchgemacht. wenn du nicht 3 kollegen hast, die nur anträge schreiben, bist du verloren. die nkp hilft, aber nicht genug
Oliver Sy
Die Struktur von Horizon Europe ist ein Meisterwerk der kooperativen Forschungsarchitektur. Die drei Säulen - wissenschaftliche Exzellenz, globale Herausforderungen und innovatives Europa - schaffen ein synergetisches Ökosystem, das nationale Silos überwindet. Die Integration von Querschnittsthemen wie Digitalisierung und Geschlechtergerechtigkeit ist nicht nur politisch korrekt, sondern epistemologisch notwendig. Österreichs Position als Top-4-Per-Capita-Förderempfänger ist ein Indikator für eine hochgradig effiziente Wissensinfrastruktur.
Steffen Ebbesen
Was für ein Geldverschwendung. 95 Milliarden für ein Programm, das nur die großen Uni-Bullaugen bereichert. Die kleinen Institute? Fressen den Staub. Und wer zahlt das? Wir. Und das alles, damit Spanier und Finnen mitreden können. Wo bleibt die deutsche Forschung?
Stephan Brass
95 milliarden für ein programm das von 12 leuten geschrieben wird und von 3000 büros geprüft wird das ist nicht forschung das ist bürokratie mit zielsetzung
Sven Schoop
Und wieder mal: Wer nicht mitmacht, ist ein Feind der EU! Wer nicht 380 Stunden in Anträge steckt, ist faul! Wer nicht mit der Ukraine und Polen kooperiert, ist ein Nationalist! Wer nicht jede Ausschreibung abschickt, ist ein Verlierer! Ich hab’ doch nur einen Laborplatz und einen Laptop - und ihr verlangt mir den Kopf ab!
Markus Fritsche
Was ist eigentlich Forschung, wenn nicht ein Versuch, gemeinsam etwas zu verstehen, das keiner allein versteht? Horizon Europe ist kein Geldtopf - es ist ein Raum, in dem wir lernen, mit anderen zu denken. Und das ist das Seltsame: Wir schreiben Anträge auf Englisch, arbeiten mit Leuten aus Finnland, und am Ende bauen wir etwas, das uns alle ein bisschen verändert. Vielleicht ist das der wirkliche Preis - nicht das Geld, sondern die Veränderung der Perspektive.
Frank Wöckener
Und wieder einmal: Wer sagt, dass Kultur- und Geisteswissenschaften unwichtig sind, der hat nie ein Buch gelesen. 2,8 % für Sozialwissenschaften? Das ist kulturelle Selbstmordpolitik. Wer die Seele der Gesellschaft ignoriert, baut nur Beton - und der verrottet schneller als die EU-Förderregeln.
Markus Steinsland
Die Konsortialbildung ist das zentrale Problem - nicht die Bürokratie. Wer keine internationalen Netzwerke hat, ist chancenlos. Die NKP ist kein Support-Service, sondern ein strategisches Asset. Wer sie erst am Ende kontaktiert, hat schon verloren. Die Erfolgsquote von 18,7 % steigt nicht durch Glück - sie wächst durch Systematik.
Rosemarie Felix
Die BOKU hat 8,3% Erfolgsquote? Ach echt? Dann hat die doch gar kein Konzept, oder? Warum machen die nicht einfach was Sinnvolles? Ich hab’ mal ein Projekt in Biochemie gesehen - da hat keiner gewusst, was ein ERC Grant ist. Das ist doch lächerlich
Lea Harvey
Österreich ist zu europäisch geworden. Wir geben Millionen an Ukrainer und Spanier und unsere eigenen Leute verhungern. Warum zahlen wir für die ganze EU wenn wir hier genug Probleme haben
Jade Robson
Ich hab’ vor zwei Jahren einen Antrag mit zwei Kollegen aus der Schweiz und einem Startup aus Graz geschrieben - und er ist durchgefallen. Aber wir haben gelernt. Beim zweiten Mal haben wir die NKP eingeschaltet, den Antrag auf 15 Seiten gekürzt und uns auf eine einzige Mission konzentriert. Jetzt haben wir ein Pilotprojekt. Es ist nicht perfekt. Aber es läuft. Und das zählt.
Matthias Kaiblinger
Horizon Europe ist kein Förderprogramm - es ist ein kulturelles Projekt der europäischen Identität. Es geht nicht nur um Forschung, sondern darum, dass ein Student aus Linz mit einem Forscher aus Kiew gemeinsam eine Methode entwickelt, die dann in Nigeria angewendet wird. Das ist kein Zufall. Das ist Absicht. Und wer das nicht versteht, versteht nicht, was Europa wirklich bedeutet: nicht die Summe von Nationen, sondern die Schaffung eines gemeinsamen Raumes des Denkens. Die Geisteswissenschaften sind nicht das Problem - sie sind die Grundlage. Ohne sie bleibt Forschung blind. Und blindes Wissen ist gefährlich.