Stell dir vor, du bist Lehrerin in einer 7. Klasse in Graz. 28 Schüler:innen sitzen vor dir. Einige brauchen mehr Zeit beim Lesen, andere verstehen Mathematik sofort, aber haben Schwierigkeiten mit dem mündlichen Ausdruck. Ein Kind sitzt im Rollstuhl, ein anderes braucht eine Sprachförderung, weil es erst vor zwei Jahren nach Österreich gekommen ist. Wie schaffst du es, dass alle lernen - wirklich alle? In Österreich antwortet man darauf mit Teamteaching.
Was genau sind kooperative Klassen?
Kooperative Klassen in Österreich sind kein Experiment, sondern seit 2012 fester Bestandteil der Mittelschule. Sie basieren auf einem einfachen Prinzip: Zwei oder mehr Lehrkräfte unterrichten gemeinsam eine Klasse - nicht nebeneinander, sondern wirklich zusammen. Das ist kein zusätzlicher Förderunterricht, den ein Kind verpasst, sondern Unterricht, der für alle gleichzeitig stattfindet. Die Idee ist nicht, Kinder mit besonderen Bedürfnissen abzusondern, sondern die Klasse als eine Gemeinschaft zu sehen, in der Unterschiede Normalität sind.
Das ist kein neues Konzept aus den USA, sondern eine Antwort auf die Realität österreichischer Schulen. Laut dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (2020) wird Teamteaching besonders in Deutsch, Mathematik und Englisch eingesetzt - also in den Fächern, in denen die Lernunterschiede am größten sind. Die Lehrkräfte arbeiten dabei nicht als Ersatz für eine:n Sonderpädagog:in, sondern als ein Team, das gemeinsam verantwortlich ist für jeden einzelnen Schüler:in.
Wie funktioniert Teamteaching in der Praxis?
Es gibt nicht nur eine Art, zwei Lehrkräfte zusammenarbeiten zu lassen. Die drei häufigsten Modelle sind:
- Parallel Teaching: Die Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Lehrkraft arbeitet mit einer Gruppe, die andere mit der zweiten. So kann man intensiver auf einzelne Lerngruppen eingehen - etwa bei Rechtschreibübungen oder beim Üben von Bruchrechnung.
- Alternative Teaching: Eine Lehrkraft unterrichtet die Mehrheit der Klasse, während die andere mit einer kleinen Gruppe von Kindern arbeitet, die zusätzliche Unterstützung brauchen - etwa beim Verstehen von Texten oder bei der Entwicklung von Lernstrategien.
- Team-Teaching: Beide Lehrkräfte sind gleichzeitig präsent und arbeiten gemeinsam. Sie wechseln sich ab, ergänzen sich, stellen Fragen, erklären aus unterschiedlichen Perspektiven. Das ist die anspruchsvollste Form, aber auch die wirkungsvollste, wenn es um Integration geht.
Ein konkretes Beispiel aus einer Wiener Schule: In der 6. Klasse unterrichten eine Regelklassenlehrerin und eine sonderpädagogisch ausgebildete Kollegin gemeinsam den Deutschunterricht. Während die eine einen Text vorliest, erklärt die andere mit Bildern und Gesten, was passiert. Ein Kind, das Schwierigkeiten mit dem Schreiben hat, bekommt von der zweiten Lehrkraft ein Arbeitsblatt mit Lücken - und wird dabei von beiden unterstützt. Keiner wird isoliert, keiner wird ausgegrenzt.
Warum funktioniert das besser als früher?
Früher hieß Inklusion oft: „Komm raus, wir machen jetzt Förderung.“ Kinder mit Lernschwierigkeiten wurden aus dem Klassenraum geholt, in einen separaten Raum gebracht - und kamen oft erst nach einer Stunde zurück. Das hat nicht integriert, es hat isoliert. Teamteaching macht das Gegenteil: Es bringt die Unterstützung direkt in den Alltag.
Studien von Cook, Hurley-Chamberlain & Shamberger (2010) zeigen: Wenn Regel- und Sonderpädagog:innen gemeinsam unterrichten, steigt die Teilhabe von Kindern mit Behinderungen um bis zu 40 Prozent. Sie nehmen aktiver am Unterricht teil, stellen mehr Fragen, fühlen sich sicherer. Und das gilt nicht nur für Kinder mit Diagnose - auch leistungsstarke Schüler:innen profitieren. Sie lernen, dass unterschiedliche Wege zum Ziel führen, dass Hilfe nicht als Schwäche gilt, sondern als Teil des Lernens.
Ein weiterer Vorteil: Die Lehrkräfte lernen voneinander. Die Regelklassenlehrerin lernt, wie man komplexe Inhalte visuell vermittelt. Die Sonderpädagogin lernt, wie man mit einer ganzen Klasse arbeitet, ohne einzelne zu überfordern. Beide werden besser - und das spürt die ganze Klasse.

Was braucht es, damit es funktioniert?
Teamteaching ist kein Zauberstab. Es braucht mehr als zwei Lehrkräfte im Raum. Es braucht:
- Zeit für Planung: Gemeinsame Vorbereitung ist kein Bonus, sondern Voraussetzung. Ohne Absprache läuft nichts. Das bedeutet: mindestens eine Stunde pro Woche, in der beide Lehrkräfte gemeinsam planen - nicht nur was, sondern wie und warum.
- Vertrauen: Eine Lehrkraft muss darauf vertrauen können, dass die andere das Kind gut unterstützt - auch wenn sie es anders macht. Keiner darf das Gefühl haben, die andere macht es „richtiger“.
- Schulleitung, die hintersteht: Ohne Unterstützung von der Schulleitung - etwa durch flexible Stundenpläne, reduzierte Unterrichtsstunden für Planung oder Fortbildungen - bricht das Modell zusammen.
- Fortbildung, die wirklich hilft: Viele Lehrkräfte haben Teamteaching nie gelernt. Das BiFoKi-Projekt (Bildungsforschung zur Kooperation in inklusiven Schulen) zeigt: Mit strukturierten Fortbildungsmodulen - für Jahrgangsteams, Schulleitungen und Eltern - steigt die Qualität der Zusammenarbeit deutlich.
Ein Lehrer aus Linz beschreibt es so: „Die ersten drei Monate waren chaotisch. Wir haben uns gestritten, wer was macht. Dann haben wir angefangen, jeden Montag 45 Minuten gemeinsam zu planen. Seitdem fühlt sich der Unterricht anders an. Nicht leichter - aber menschlicher.“
Welche Herausforderungen gibt es?
Ja, es gibt Probleme. Teamteaching ist nicht immer einfach. Die größten Hürden sind:
- Zu wenig Zeit: Lehrkräfte arbeiten oft an der Belastungsgrenze. Gemeinsame Planung ist oft der erste Punkt, der wegfällt, wenn es eng wird.
- Kein Budget für zwei Lehrkräfte: In vielen Schulen gibt es nur eine Lehrkraft pro Klasse. Teamteaching braucht zwei - und das kostet Geld. Die Politik hat das Konzept zwar beschlossen, aber nicht ausreichend finanziert.
- Widerstand aus der Tradition: Manche Lehrkräfte denken: „Ich kann das doch alleine.“ Oder: „Das ist nur für die schweren Fälle.“ Doch Inklusion ist kein Zusatzangebot - sie ist der Standard.
- Keine klare Aufgabenverteilung: Wenn beide Lehrkräfte dieselbe Rolle übernehmen, entsteht Verwirrung. Wer ist verantwortlich, wenn ein Kind nicht mitkommt? Die Antwort: Beide.
Kritiker wie Feyerer (2015) weisen darauf hin, dass Teamteaching in der Praxis oft nur halbherzig umgesetzt wird - als „Dekoration“ für Inklusion, ohne echte Veränderung der Unterrichtskultur. Das ist der größte Fehler. Teamteaching ist kein Werkzeug, um Inklusion zu „erledigen“. Es ist eine Haltung.

Was macht den Erfolg wirklich aus?
Experten wie Lütje-Klose, Wild, Grüter und Kollegen (2024) haben in ihrem Praxishandbuch fünf Schlüsselmerkmale identifiziert, die erfolgreiche inklusive Schulen ausmachen:
- Heterogenität als Normalität: Unterschiede sind kein Problem - sie sind Ressource.
- Wertschätzung aller: Jede:r Schüler:in zählt - egal, wie gut er/sie in einer Prüfung abschneidet.
- Hohe Erwartungen für alle: Kein Kind wird herabgesetzt. Die Anforderungen werden angepasst, nicht reduziert.
- Gemeinsame Verantwortung: Es gibt keine „meine“ und „deine“ Kinder. Alle Kinder gehören allen Lehrkräften.
- Unterstützende Schulleitung: Ohne Führung, die Raum schafft, bleibt Teamteaching ein Wunschtraum.
Das ist kein theoretisches Modell. Das ist das, was in Schulen funktioniert - wenn man es ernst nimmt.
Was kommt als Nächstes?
Die österreichische Bildungspolitik hat sich 2012 verpflichtet, Inklusion umzusetzen - und das ist kein vorübergehender Trend. In den nächsten Jahren wird Teamteaching nicht nur in der Mittelschule, sondern auch in der AHS-Unterstufe und in den Volksschulen weiter ausgebaut. Die Frage ist nicht, ob es kommt - sondern wie gut es umgesetzt wird.
Ein wichtiger Schritt ist die Entwicklung von Professional Learning Communities - also Netzwerken von Lehrkräften, die sich regelmäßig austauschen, Erfahrungen teilen und gemeinsam lernen. Diese Communities sind die unsichtbare Infrastruktur, die Teamteaching trägt.
Was bleibt? Teamteaching ist kein perfektes System. Aber es ist das beste, das wir haben. Es verändert nicht nur den Unterricht - es verändert die Schule. Es macht sie zu einem Ort, an dem Kinder nicht nur lernen, sondern auch lernen, miteinander zu leben.
Was ist der Unterschied zwischen Teamteaching und Förderunterricht?
Förderunterricht findet meist außerhalb der Klasse statt - ein Kind wird herausgenommen, um individuell gefördert zu werden. Teamteaching findet in der Klasse statt - beide Lehrkräfte sind gleichzeitig da, und alle Kinder lernen gemeinsam. Die Förderung ist nicht ein Zusatz, sondern Teil des regulären Unterrichts.
Braucht man dafür mehr Geld?
Ja. Teamteaching braucht zwei Lehrkräfte statt einer - das bedeutet mehr Personal. Aber es reduziert die Notwendigkeit für separate Fördergruppen, Sonderklassen oder externe Unterstützung. Langfristig kann es sogar Kosten sparen, weil weniger Kinder abgehängt werden und später teure Nachhilfe oder Wiederholungen nötig sind.
Kann man Teamteaching auch ohne sonderpädagogische Ausbildung machen?
Ja, aber es wird schwieriger. Die beste Wirkung entsteht, wenn eine Lehrkraft fachlich ausgebildet ist (z. B. Deutsch) und die andere spezifische Kenntnisse in Differenzierung, Lernförderung oder sonderpädagogischer Diagnostik hat. Beide sind wichtig. Ohne spezifische Kompetenzen kann Teamteaching schnell zur Überforderung werden.
Wie lange dauert es, bis Teamteaching wirkt?
Es dauert drei bis sechs Monate, bis die Lehrkräfte ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben und die Zusammenarbeit flüssig läuft. Die ersten Ergebnisse bei den Schülern - etwa mehr Teilhabe, weniger Verhaltensauffälligkeiten - zeigen sich oft schon nach zwei Monaten. Aber echte Veränderung braucht Zeit.
Warum funktioniert Teamteaching nicht in allen Schulen?
Weil es an drei Dingen scheitert: Zeit, Vertrauen und Führung. Wenn Schulleitungen keine Planungszeit einräumen, wenn Lehrkräfte sich nicht trauen, gemeinsam zu planen, oder wenn sie glauben, Inklusion sei nur eine Aufgabe für Sonderpädagog:innen - dann bleibt Teamteaching eine Theorie. Es braucht Mut, sich anders zu organisieren.




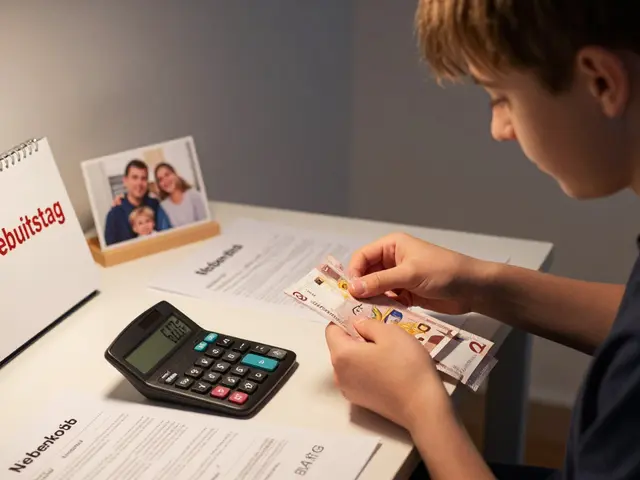


14 Kommentare
Maximilian Erdmann
Teamteaching? Cool, aber wer zahlt die zwei Lehrer? 😅 Wir haben hier in Deutschland noch nicht mal genug Lehrer für eine Klasse…
Rolf Jahn
Ach ja, wieder Österreich mit seinem Wohlfühl-Inklusions-Paradies. 🙄 In der Realität läuft das doch nur, wenn die Schulleitung nicht aufpasst und die Lehrer sich selbst ausbeuten. Wer hat Zeit für so viel 'Menschlichkeit'?
Günter Rammel
Ich hab das in einer Schule in Köln gesehen – und es funktioniert. Nicht perfekt, aber besser als alles, was wir sonst haben. Der Schlüssel ist: Planungszeit. Wenn die Schule die nicht gibt, wird’s zum Theater. Aber wenn’s läuft? Dann merken die Kinder das. Die, die sonst immer abgehängt wurden, fangen an, mitzumachen. Das ist kein Zauber, das ist Arbeit. Und sie lohnt sich.
Helga Goldschmidt
Das klingt wirklich gut. Aber ich frage mich, ob das wirklich überall umsetzbar ist – oder nur in gut ausgestatteten Schulen in Graz oder Wien?
Kristian Risteski
Ich komme aus Norwegen, und wir machen so was auch. Aber hier wird es oft als 'Differenzierung' verpackt, nicht als echte Zusammenarbeit. Echt interessant, wie ihr das als 'Normalität' beschreibt – das ist der Punkt, der fehlt. Nicht 'für die besonderen Kinder', sondern für ALLE. Das ist der große Unterschied.
Birgit Lehmann
Ich bin Lehrerin und hab das in meiner Klasse ausprobiert – mit einer Kollegin, die keine Sonderpädagogin ist, aber super gut zuhört. Wir haben 3 Monate gebraucht, bis wir uns eingespielt haben. Aber jetzt? Die Kinder sind ruhiger, konzentrierter, und die Eltern sagen: 'Endlich fühlt sich die Schule an wie ein Ort, an dem mein Kind dazugehört.' Das ist mehr als Bildung. Das ist Menschlichkeit.
Arno Raath
Teamteaching – ein poetisches Konstrukt, das die tiefere Krise der pädagogischen Existenz verdeckt. Wir haben nicht zu wenig Lehrer, sondern zu wenig *Sehnsucht nach Gemeinschaft*. Die Schule ist kein Produktionsbetrieb für Leistung, sondern ein ritueller Raum, in dem Identitäten entstehen. Und wer das nicht versteht, der sieht nur die zwei Köpfe im Raum – nicht die zwei Herzen, die endlich lernen, im Einklang zu schlagen.
Koray Döver
Das ist doch alles nur ein riesiger Bluff. Wer sagt, dass ein Kind mit Sprachförderbedarf in der normalen Klasse besser aufgehoben ist? Ich hab gesehen, wie so ein Kind stundenlang nur rumgesessen hat, weil keiner auf ihn einging. Das ist keine Inklusion – das ist Vernachlässigung mit einem schönen Namen. Und jetzt noch zwei Lehrer dafür? Die werden nur noch mehr Stress haben!
Und wer bezahlt das? Die Eltern? Die Steuerzahler? Nein, das wird irgendwann wieder abgeschafft, weil es zu teuer ist. Und dann? Dann ist das Kind wieder allein. Mit einem Zettel, auf dem steht: 'Förderbedarf'.
Thomas Lüdtke
Teamteaching… ja, klingt gut. Aber in der Praxis? Die eine Lehrerin macht alles, die andere steht nur rum und guckt. 😴
Nadja Blümel
Ich hab das mal in einer Schule erlebt. Es war nicht perfekt. Aber es war das erste Mal, dass ein Kind mit Down-Syndrom nicht mehr als 'Problem' gesehen wurde, sondern als jemand, der Fragen stellt – und manchmal sogar besser antwortet als die anderen. Das war mehr wert als alle Tests.
Erwin Vallespin
Was ist eigentlich die Seele der Schule? Ist es die Leistung? Der Notendurchschnitt? Oder ist es der Moment, in dem ein Kind, das nie etwas sagt, plötzlich ein Lächeln bekommt, weil jemand – nicht eine Lehrerin, nicht eine Sonderpädagogin – sondern *zwei* Menschen gemeinsam ihm zuhören? Teamteaching ist kein Modell. Es ist ein Akt des Widerstands. Gegen die Maschine. Gegen die Logik, die Kinder nach ihrer Nutzbarkeit misst. Es ist die Erinnerung: Wir lernen nicht, um zu bestehen. Wir lernen, um zu gehören.
Jan Whitton
Das ist doch ein Traum aus der linken Ecke! Wer zahlt das? Wer soll das bezahlen? Wir haben genug Probleme mit der Integration – und jetzt sollen wir noch zwei Lehrer pro Klasse finanzieren? Nein! Das ist kein Fortschritt – das ist Verschwendung! Inklusion heißt nicht, dass jeder alles mitmachen muss. Einige Kinder brauchen eben eigene Räume! Und wer das nicht akzeptiert, der lebt in einer Welt der Illusionen!
Ahmed Berkane
Teamteaching? Ja, schön und gut – aber nur, wenn die Lehrer *deutsch* sprechen! Was ist, wenn die Kollegin, die mit dem Kind arbeitet, kein Deutsch als Muttersprache hat? Dann wird aus Inklusion eine Sprachbarriere! Und wer kümmert sich um die Kinder, die *nicht* behindert sind, aber trotzdem leistungsfähig sein sollen? Die werden doch nicht vernachlässigt?!
Und warum immer nur Österreich? Warum nicht mal Deutschland? Weil wir hier keine Zeit haben für solche Spielereien! Wir brauchen klare Strukturen – nicht emotionale Theaterstücke!
Christian Suter
Die hier beschriebene Praxis stellt einen paradigmatischen Wandel in der pädagogischen Epistemologie dar. Es handelt sich nicht um eine didaktische Innovation, sondern um eine ontologische Neuausrichtung des Bildungswesens: Von der Hierarchie der Kompetenz zur Horizontalität der Teilhabe. Die institutionelle Verankerung dieses Modells erfordert eine strukturelle Rekonfiguration der Lehrerbildung, der Finanzierungslogik und der administrativen Governance. Die fünf Schlüsselmerkmale, die von Lütje-Klose et al. identifiziert wurden, bilden ein ethisches Fundament, das über die bloße Effizienz hinausgeht und die Schule als soziales Gemeinwesen rekonstituiert. Eine solche Transformation ist nicht nur wünschenswert – sie ist unumgänglich.