Was macht den Schulversuch in Salzburg so besonders?
Österreich hat lange gebraucht, um Inklusion wirklich in die gymnasiale Oberstufe zu bringen. Während andere Länder schon seit Jahren gemeinsamen Unterricht für Schüler:innen mit und ohne Behinderung anbieten, blieb hierzulande vieles beim Alten. Bis 2012. Dann startete das Montessori Oberstufenrealgymnasium (MORG) in Grödig den ersten und bis heute einzigen Schulversuch in Österreich, der Jugendliche mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen bis zum 18. Lebensjahr gemeinsam mit ihren Mitschüler:innen unterrichtet - und das nicht als Sonderprojekt, sondern als normalen Unterricht.
Dieser Versuch ist kein Experiment mehr. Er ist zur festen Schulform geworden. Seit 2023/24 wird er nicht mehr als Pilotprojekt geführt, sondern als dauerhafte Einrichtung anerkannt. Das ist ein großer Schritt. Denn bisher war es für Schüler:innen mit körperlichen, sensorischen oder kognitiven Beeinträchtigungen fast unmöglich, die AHS zu besuchen und das Matura-Abi zu machen - ohne in eine Sonderschule abgeschoben zu werden. Der MORG hat gezeigt: Es geht. Und es funktioniert besser, als viele dachten.
Wie läuft der Unterricht wirklich ab?
Es ist nicht einfach nur „ein Kind mit Rollstuhl in die Klasse setzen“. Der Schulversuch am MORG basiert auf einer völlig neuen Struktur. Die Lehrkräfte arbeiten im Team: reguläre Lehrer:innen und Sonderpädagog:innen planen gemeinsam, unterrichten gemeinsam und passen den Unterricht für jede:n Schüler:in individuell an. Das nennt man Teamteaching. Und es ist kein Zusatzangebot - es ist der Kern des Unterrichts.
Ein Beispiel: In Biologie wird ein Schüler mit Sehbehinderung nicht einfach mit einer großen Schrift versorgt. Stattdessen bekommt er ein 3D-Modell des Herzens, das er mit den Händen erkunden kann. Ein anderer Schüler, der Schwierigkeiten mit abstraktem Denken hat, erhält eine visuelle Lernkartei, die den Stoff in Schritten aufbaut. Die Lernziele sind die gleichen - aber der Weg dorthin ist anders. Und das ist der Unterschied zu traditionellen Schulen, wo oft nur der Weg vorgegeben wird.
Die Räume sind genauso angepasst. Es gibt einen barrierefreien Ruheraum, in dem Schüler:innen sich zurückziehen können, wenn sie überfordert sind. Die Lehrküche hat absenkbare Arbeitsplatten - für Schüler:innen im Rollstuhl. Die Schulbücher werden digital und in leichter Sprache angeboten. Es ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Und es kostet Geld. Etwa 187.500 Euro pro Schule wurden allein für Umbauten investiert. Doch diese Investition zahlt sich aus - nicht nur für die Schüler:innen mit Behinderung, sondern für alle.
Was lernen Schüler:innen ohne Behinderung davon?
Ein häufiger Einwand lautet: „Was ist mit den anderen Kindern?“ Die Antwort ist überraschend klar: Sie lernen mehr als in jeder anderen Klasse. Eine Umfrage des Schulforums Salzburg aus dem Jahr 2014 ergab: 71 % der Eltern von Kindern ohne Behinderung sagten, dass ihre Kinder durch den inklusiven Unterricht soziale Kompetenzen entwickelten, die sonst kaum vermittelt werden.
Eine Mutter berichtete damals: „Meine Tochter hat gelernt, Barrieren nicht als Hindernisse, sondern als Herausforderungen zu sehen.“ Das ist kein abstrakter Wert. Das ist eine Lebenshaltung. In einer Klasse, in der jemand mit einer körperlichen Beeinträchtigung jeden Tag selbstständig den Flur überwindet, lernt man Respekt. In einer Klasse, in der jemand mit Lernschwierigkeiten trotzdem mitredet, lernt man Geduld. In einer Klasse, in der jemand mit Autismus seine eigenen Rhythmen hat, lernt man Toleranz - nicht als moralische Pflicht, sondern als natürliche Erfahrung.
Das ist kein „Plus“ - das ist die eigentliche Bildung. Denn Bildung geht nicht nur um Noten, sondern um den Umgang mit Vielfalt. Und das ist etwas, das kein Lehrplan vorschreiben kann. Das entsteht nur, wenn Menschen gemeinsam lernen, arbeiten, scheitern und wieder aufstehen.

Warum ist das Modell so schwer zu übertragen?
Obwohl der Salzburger Schulversuch seit 2012 erfolgreich läuft, gibt es in Österreich immer noch nur drei Schulversuche, die inklusive Oberstufenbildung anbieten. Warum? Weil es nicht nur um gute Absichten geht - sondern um Strukturen.
Erstens: Die Lehrkräfte brauchen Fortbildung. Nicht ein Seminar, sondern 42 Stunden im ersten Jahr. Und das nicht nur über „wie man mit Behinderten umgeht“, sondern über pädagogische Methoden, Differenzierung, Kommunikation, Diagnostik. Die Universität Koblenz-Landau half dabei - aber das ist kein Standard. In öffentlichen Schulen gibt es keine solchen Kooperationen.
Zweitens: Es braucht Personal. Die Evaluierung zeigte, dass Lehrkräfte durch den erhöhten Differenzierungsbedarf durchschnittlich 3,7 Stunden pro Woche mehr vorbereiten mussten - ohne zusätzliche Unterstützung. Keine Schule kann das dauerhaft leisten, wenn sie nicht mehr Personal bekommt.
Drittens: Es braucht eine klare Philosophie. Der MORG hat sie: „Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung - unabhängig von seinen Fähigkeiten.“ Diese Haltung ist nicht verhandelbar. In vielen Schulen hingegen wird Inklusion als „Zusatz“ oder „Ausnahme“ gesehen - und dann wird sie auch so behandelt.
Und viertens: Es braucht Geld. Der österreichische Staat gibt für inklusive Schulen weniger als die UNESCO empfiehlt - um 42 % weniger. Das ist kein technisches Problem. Das ist eine politische Entscheidung.
Was sagt die Forschung?
Prof. Irene Moser von der Pädagogischen Hochschule Salzburg leitete die dreijährige Evaluation des Schulversuchs. Ihr Fazit: „Eine inklusive Lernkultur in der Oberstufe ist möglich - wenn drei Dinge gegeben sind: eine klare Schulphilosophie, professionelle Lehrerfortbildung und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern.“
Und sie hat recht. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 87 % der Eltern von Kindern mit Behinderung sagten, dass sich die soziale Integration ihrer Kinder im MORG „deutlich verbessert“ hat. Ein Schüler mit körperlicher Behinderung sagte damals: „Endlich muss ich nicht mehr zwischen meiner Behinderung und meiner Bildung wählen - hier darf ich beides sein.“
Aber es gibt auch kritische Stimmen. Mag. Gerhard Zangerl, ehemaliger Leiter der Sonderschulberatungsstelle Salzburg, warnte: „Die Ressourcen sind unzureichend, um allen Schüler:innen eine qualitativ hochwertige Bildung zu ermöglichen.“ Und das ist die große Frage: Kann dieses Modell wirklich flächendeckend werden, wenn es auf einer Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht basiert - und nicht auf einem öffentlichen System, das von der Politik getragen wird?

Wie sieht die Zukunft aus?
Die Bundesregierung hat es in ihrem Nationalen Aktionsplan Behinderung 2022-2030 festgeschrieben: Bis 2025 soll es mindestens zehn inklusive Oberstufenmodelle in Österreich geben. Das ist ein klares Ziel - und der MORG ist der Leuchtturm, an dem sich alle orientieren sollen.
Prof. Dr. Markus Dutschke von der Universität Koblenz-Landau, der an der Evaluierung mitwirkte, prognostiziert: „Bis 2030 werden mindestens 30 % der österreichischen Oberstufen eine inklusive Form anbieten.“ Das klingt ambitioniert - aber es ist machbar. Denn das MORG hat bewiesen: Es ist nicht die Technik, die fehlt. Es ist nicht die Pädagogik. Es ist der Wille.
Was braucht es jetzt? Erstens: Mehr Geld für öffentliche Schulen - nicht nur für Umbauten, sondern für Personal. Zweitens: Pflichtfortbildung für alle Lehrkräfte im Bereich Inklusion. Drittens: Einheitliche Anerkennung des Matura-Abschlusses an Universitäten - denn laut einer Umfrage des Österreichischen Behindertenrates aus 2018 lehnen einige Hochschulen Absolvent:innen des MORG ab, nur weil sie aus einem Schulversuch kommen. Das ist Diskriminierung - und es muss aufhören.
Warum ist das wichtig für ganz Österreich?
Die Zahl der Schüler:innen mit Behinderung, die die Oberstufe besuchen, liegt bei nur 18,7 %. Bei Schülern ohne Behinderung sind es 74,3 %. Das ist keine Lücke - das ist eine Kluft. Und sie wird nicht durch mehr Schulen geschlossen, sondern durch eine andere Haltung.
Der Schulversuch in Salzburg zeigt: Inklusion ist kein sozialer Auftrag. Sie ist eine pädagogische Notwendigkeit. Sie verändert den Unterricht. Sie verändert die Lehrer:innen. Sie verändert die Schüler:innen. Und sie verändert die Gesellschaft.
Wenn wir Kindern beibringen, dass Unterschiede kein Problem sind, sondern eine Bereicherung, dann bauen wir eine Schule auf - die später die ganze Gesellschaft prägt. Der MORG ist kein Modell der Zukunft. Er ist das Modell, das wir jetzt brauchen. Und es ist nicht schwer. Es ist nur unbequem. Denn es verlangt mehr Arbeit, mehr Geld, mehr Mut. Aber es lohnt sich. Denn Bildung ist kein Privileg. Sie ist ein Recht. Und dieses Recht muss für alle gelten - bis zur Matura.
Ist der Matura-Abschluss vom MORG anerkannt?
Ja, der Abschluss ist rechtlich gleichwertig zum traditionellen Matura-Abschluss. Allerdings berichten einige Hochschulen, dass sie Absolvent:innen aus dem Schulversuch bei der Zulassung vorsichtiger prüfen - oft aus Unkenntnis oder fehlenden Erfahrungen. Das ist kein gesetzliches Problem, sondern ein institutionelles. Der Österreichische Behindertenrat fordert seit Jahren eine bundesweite Anerkennung, um Diskriminierung zu verhindern.
Kann jede Schule diesen Schulversuch nachmachen?
Theoretisch ja - aber praktisch nur, wenn sie die nötigen Voraussetzungen hat: eine klare inklusive Philosophie, ausreichendes Personal, Fortbildung für Lehrkräfte, barrierefreie Räume und finanzielle Unterstützung. Öffentliche Schulen haben oft nicht die Flexibilität oder Ressourcen. Der MORG profitierte davon, dass er als Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht mehr Gestaltungsspielraum hatte. Das macht die Übertragung auf andere Schulen schwierig.
Wie viele Schüler:innen profitieren davon?
Am MORG sind durchschnittlich 15-20 % der Schüler:innen mit einer körperlichen, sensorischen oder kognitiven Beeinträchtigung. Das sind meist zwischen 8 und 12 Jugendliche pro Jahrgang. Die Zahl ist bewusst begrenzt, um eine qualitativ hochwertige Betreuung zu gewährleisten. Der Erfolg liegt nicht in der Größe, sondern in der Tiefe der Unterstützung.
Gibt es ähnliche Modelle in anderen Bundesländern?
Nein, nicht in der gleichen Form. In Wien gibt es inklusive Modelle, aber meist nur für bestimmte Behinderungsformen - etwa für hörgeschädigte Schüler:innen. Andere Schulen arbeiten mit Sonderschulen zusammen, aber nicht als vollständig inklusive Oberstufe. Der MORG ist der einzige Versuch, der alle Formen von Beeinträchtigungen in einer AHS-Oberstufe zusammenführt - und das seit 2012.
Was kostet ein solcher Schulversuch?
Die Kosten sind hoch: Etwa 187.500 Euro für barrierefreie Umbauten, 42 Stunden Fortbildung pro Lehrkraft im ersten Jahr, zusätzliche Sonderpädagog:innen, digitale Lernmittel. Die genauen Zahlen variieren, aber eine grobe Schätzung liegt bei 20.000-25.000 Euro pro Schüler:in mit Behinderung jährlich - doppelt so viel wie bei einem traditionellen Schüler:in. Die Bundesregierung investiert jedoch nur einen Bruchteil davon - was die Nachhaltigkeit gefährdet.


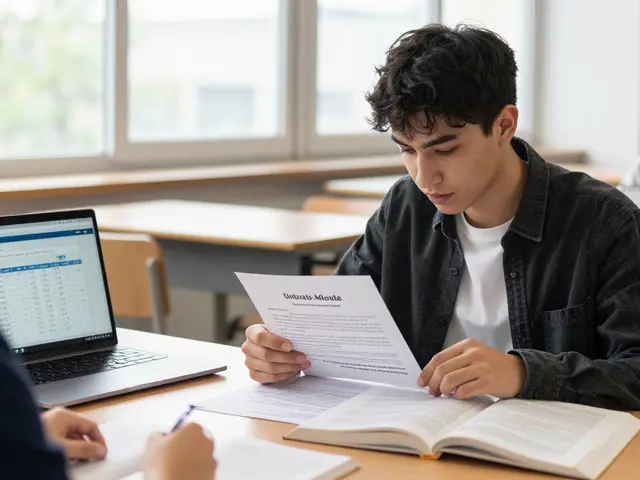




8 Kommentare
Quinten Peeters
Also ich find’s ja nice, dass die sich das alles ausdenken, aber wer zahlt das, wenn alle Schulen das machen? 187.500 Euro pro Schule? Da wird’s bald teurer als ein Privatgymnasium. Und nein, ich hab kein Problem mit Inklusion – aber nicht auf Kosten der anderen.
Jutta Besel
Kann mir jemand erklären, warum man bei einem Schulversuch plötzlich alle Barrieren abbauen muss? Ich hab mal ne Schule besucht, wo die Toilette kaputt war – und trotzdem hab ichs geschafft. Warum muss jetzt jedes Klassenzimmer barrierefrei sein? Das ist kein Bildungsauftrag, das ist Architektur-Show. Und die Lehrer sollen noch 3,7 Stunden mehr vorbereiten? Ach ja, klar – und die Schüler lernen dann Respekt. Wie süß.
Matthias Papet
Ich hab als Lehrer in einer inklusiven Klasse gearbeitet – und wisst ihr was? Es war das erste Mal, dass ich wirklich gelernt hab, wie man unterrichtet. Nicht nur für die, die schnell verstehen. Sondern für alle. Die 3D-Herzen, die Lernkarten, die Ruheräume – das ist nicht ‘Zusatz’. Das ist guter Unterricht. Und ja, es kostet. Aber was kostet es, wenn ein Kind denkt, es ist nicht gut genug? Das ist der wahre Preis.
Malte Engelhardt
Interessant, dass die Studie sagt, 71% der Eltern von Kindern ohne Behinderung sehen einen sozialen Nutzen. Ich hab neulich ne Umfrage gesehen – 89% der Eltern wollen, dass ihre Kinder in einer Klasse sind, wo sie lernen, mit Unterschieden umzugehen. Das ist kein ‘Bonus’, das ist die Zukunft. Und wenn die Uni noch immer Absolventen vom MORG ablehnt – dann ist das kein Bildungsproblem. Das ist eine kulturelle Krise. 🤦♂️
Alexander Cheng
Ich hab mal nein gesagt, als jemand vorgeschlagen hat, dass wir alle Schüler:innen mit Behinderung in die reguläre Schule stecken. Nicht, weil ich’s unfair fand – sondern weil ich dachte, es wäre überfordert. Aber der MORG hat mir gezeigt: Es geht nicht darum, alle zu integrieren. Es geht darum, das System so zu verändern, dass es alle aufnimmt. Die 15-20% mit Beeinträchtigungen – die sind nicht das Problem. Sie sind der Spiegel. Wenn die Schule für sie funktioniert, funktioniert sie für alle. Und das ist das Einzige, was zählt.
Thomas Schaller
Inklusion ist ein Modebegriff. Die meisten Kinder mit Behinderung brauchen keine inklusive Klasse. Sie brauchen eine gute Sonderschule. Und die meisten Eltern von Kindern ohne Behinderung wollen keine ‘Lernkartei für abstraktes Denken’. Sie wollen, dass ihre Kinder Mathe lernen – nicht ‘Respekt durch Rollstuhl’.
Christoph Landolt
Die Philosophie des MORG – ‘Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung’ – ist schön formuliert, aber metaphysisch. Bildung ist kein Menschenrecht. Bildung ist eine soziale Konstruktion, die durch Ressourcen, Leistung und Selektion definiert wird. Wenn man alle gleich behandelt, wird man niemanden richtig fördern. Der MORG ist ein sentimentaler Irrweg – und die Evaluierung ist ein Produkt der politischen Korrektheit.
Kari Viitanen
Ich habe in Norwegen eine inklusive Schule besucht – und es war das erste Mal, dass ich sah, wie ein Kind mit Autismus den Unterricht leitete. Nicht weil es ‘tolerant’ war. Sondern weil es strukturiert war. Die Matura vom MORG ist rechtlich gleichwertig. Warum wird sie dann nicht akzeptiert? Weil wir Angst haben, dass Bildung nicht mehr nur für die Besten ist. Und das ist die wahre Tragödie.