Was sind Sprachförderklassen und warum gibt es sie?
Wenn ein Kind zum ersten Mal eine deutsche Schule betritt und kaum Deutsch spricht, kann es nicht einfach in eine normale Klasse gesetzt werden. Es versteht nichts, fühlt sich verloren, und der Unterricht bleibt für es sinnlos. Genau deshalb gibt es Sprachförderklassen - spezielle Klassen an deutschen Schulen, die neu zugewanderte Kinder und Jugendliche mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen aufnehmen. Sie heißen auch Internationale Sprachförderklassen, Deutschförderklassen oder Sprachlernklassen. Ihr Ziel ist klar: die Kinder so schnell wie möglich so weit bringen, dass sie in reguläre Klassen wechseln können - nicht nur sprachlich, sondern auch sozial und kulturell.
Die Zahl dieser Klassen ist seit 2015/2016 stark gestiegen, als viele Familien aus Kriegsgebieten nach Deutschland kamen. In Niedersachsen allein gab es 2023 rund 550 solcher Klassen - fast doppelt so viele wie noch ein Jahr zuvor. Die Bundesländer haben darauf reagiert, indem sie Konzepte entwickelt haben, die nicht nur Deutsch lehren, sondern auch den Schulalltag verständlich machen. Die rechtliche Grundlage ist der Erlass des Landes Niedersachsen, der mindestens ein Jahr intensive Sprachförderung vorschreibt. Aber es geht nicht nur um Regeln - es geht darum, dass jedes Kind eine echte Chance bekommt.
Wie funktioniert der Unterricht in Sprachförderklassen?
Der Unterricht in diesen Klassen ist anders als in normalen Klassen. Die Stunden sind auf Deutsch als Zweitsprache fokussiert, aber nicht nur auf Vokabeln und Grammatik. Es geht um Alphabetisierung - viele Kinder kommen aus Ländern, wo das lateinische Alphabet nicht verwendet wird. Sie lernen, wie man Buchstaben schreibt, wie man Wörter liest, wie man Sätze baut. Gleichzeitig lernen sie, wie ein Schulalltag in Deutschland funktioniert: Was bedeutet "Pausenglocke"? Wie melde ich mich im Unterricht? Wo ist die Toilette?
Die Klassen sind klein - meist zwischen 10 und 16 Schülerinnen und Schülern. Das ist wichtig, denn die Lernenden haben sehr unterschiedliche Voraussetzungen. Ein 10-Jähriger aus Syrien, der in seinem Heimatland zur Schule ging, lernt anders als ein 15-Jähriger aus Afghanistan, der nie lesen und schreiben konnte. Die Lehrkräfte müssen individuell auf jeden eingehen. An manchen Schulen, wie der Gesamtschule Quelle in Bielefeld, bekommen die jüngeren Schüler (Jahrgänge 5-7) täglich die ersten beiden Stunden Deutschunterricht, während ältere Schüler (Jahrgänge 8-10) später am Tag unterrichtet werden. Die Stundenanzahl liegt bei bis zu 30 pro Woche in der Sekundarstufe I.
Aber Sprachförderung bedeutet nicht nur Deutschunterricht. Es geht auch um kulturelle Orientierung. Wer kennt die Regeln für eine Klassenarbeit? Wer weiß, wie man mit einem Lehrer spricht? Wer versteht, warum man in der Pause nicht einfach auf den Boden sitzt? Diese Dinge werden in Sprachförderklassen gelehrt - oft durch Spiele, Bilder, Alltagssituationen. An der Mörike-Schule in Nürtingingen zum Beispiel machen die Kinder gemeinsame Projekte, bei denen sie sich gegenseitig helfen, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden.
Wann und wie erfolgt der Übergang in die Regelklasse?
Der Übergang ist der entscheidende Moment. Ein Kind darf nicht ewig in der Sprachförderklasse bleiben - sonst wird es isoliert, abgehängt, ausgegrenzt. Deshalb ist der Übergang in die Regelklasse kein plötzlicher Sprung, sondern ein schrittweiser Prozess. In Niedersachsen ist vorgesehen, dass Kinder bereits nach sechs bis zwölf Wochen in bestimmte Fächer in der Regelklasse integriert werden. Und welches Fach ist am einfachsten? Sport. Dort braucht man nicht viel Deutsch, um zu verstehen: "Lauf!“, "Wirf!“, "Pass!“.
Im Laufe des Schuljahres verbringen die Kinder typischerweise die Hälfte ihrer Zeit in der Regelklasse - also etwa 15 bis 16 von 30 Wochenstunden. Sie nehmen an Fächern wie Musik, Kunst oder Sport teil, während sie weiterhin Deutschunterricht in der Sprachförderklasse bekommen. Ein Lehrer aus der Praxis sagt: "Nach sechs Wochen hat ein Kind oft schon genug Wortschatz, um bei einem Biologieprojekt mitzumachen - wenn man ihm Bilder und einfache Anweisungen gibt."
Am Ende des Schuljahres findet ein Übergabegespräch statt. Lehrer aus der Sprachförderklasse, Klassenlehrer aus der Regelklasse, manchmal auch Schulpsychologen und Eltern sprechen darüber, ob das Kind bereit ist. Manche Kinder wechseln vollständig, andere bleiben noch ein halbes Jahr in der Sprachförderklasse, um ihre Sprachkenntnisse zu festigen. Es gibt keine starre Regel - jeder Fall wird individuell bewertet. In Baden-Württemberg gibt es sogar das Modell "DeutschPLUS", bei dem Schüler in ausgewählten Fächern wie Mathematik oder Geschichte separat von der Stammklasse unterrichtet werden - aber mit einem Fokus auf Fachsprache. So lernen sie, wie man in Biologie "Zellkern" sagt, ohne den gesamten Unterricht zu verpassen.
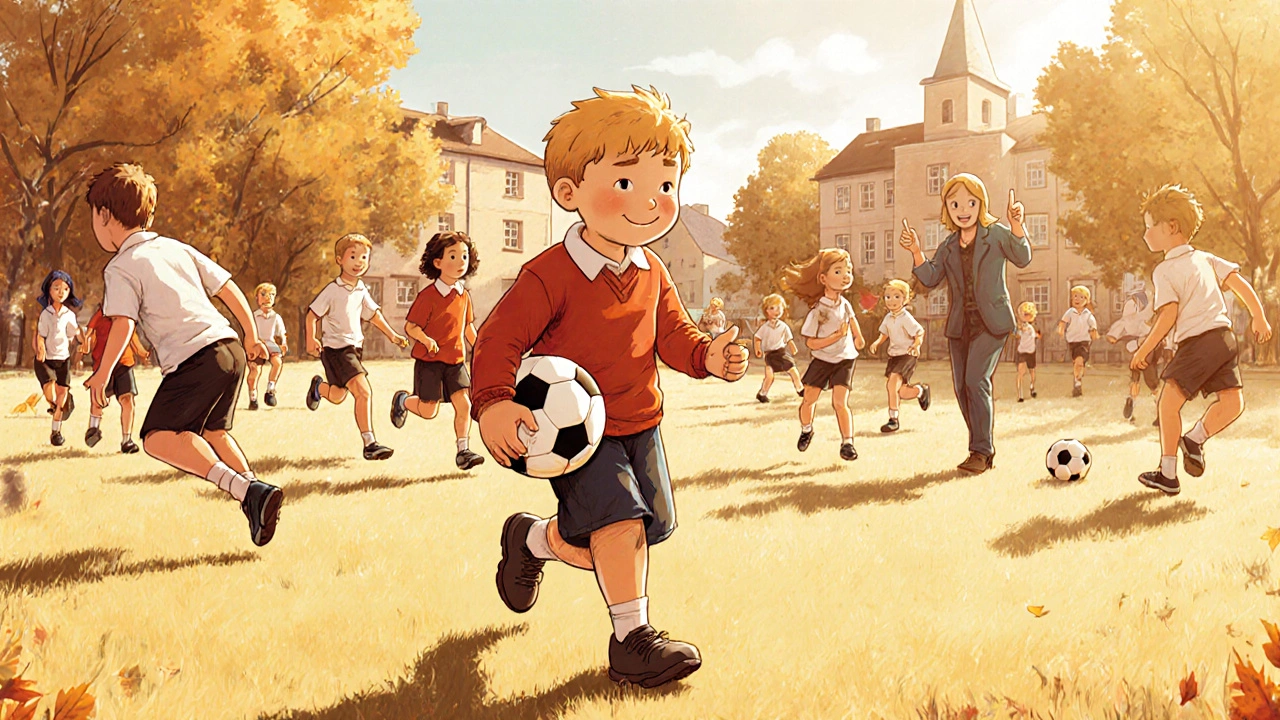
Verschiedene Modelle in den Bundesländern
Nicht jedes Bundesland macht es gleich. In Baden-Württemberg hat man einen ganz anderen Ansatz: Frühzeitige Förderung. Mit dem Programm "SprachFit" werden Kinder bereits vor der Einschulung getestet. Wer einen starken Sprachförderbedarf hat, bekommt vier Stunden pro Woche in Kleingruppen - schon im Kindergartenalter. Das Programm startet 2024/2025 mit 200 Standorten und soll bis 2027/2028 auf 4.200 Gruppen ausgebaut werden. Die Kultusministerin Theresa Schopper sagt: "Auf den Anfang kommt es an."
An Realschulen läuft das Modell "SPRINT" - Sprachförderung intensiv. Hier wird parallel zum regulären Unterricht zusätzlicher Deutschunterricht angeboten. An Gymnasien gibt es das Projekt "InGym", das speziell auf die Anforderungen eines Gymnasiums zugeschnitten ist. Dort geht es nicht nur um Alltagssprache, sondern auch um akademische Sprache - wie man in einem Aufsatz argumentiert, wie man eine wissenschaftliche Frage formuliert.
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat in ihrem Dokument "Integration als Chance" klargestellt: Sprachförderung ist kein Randthema. Sie muss Teil des gesamten Bildungssystems sein. Deshalb empfiehlt sie, dass auch Kinder, die schon in Regelklassen sind, weiterhin Förderung bekommen - wenn sie sie brauchen. In Niedersachsen können Schulen sogar Förderkurse für mindestens vier Schüler in einer Regelklasse einrichten - mit fünf bis acht Stunden pro Woche in der Sekundarstufe I.
Was macht Sprachförderung erfolgreich?
Die effektivsten Modelle kombinieren zwei Dinge: intensive, separate Sprachförderung und gleichzeitige, schrittweise Integration in die Regelklasse. Wer nur Deutsch lernt, aber nie mit deutschen Kindern spricht, bleibt fremd. Wer sofort in die Regelklasse kommt, ohne Deutsch zu können, wird überfordert. Die Lösung liegt in der Mitte.
Ein wichtiger Faktor ist die Fachsprachförderung. Ein Kind kann "Apfel" sagen, aber nicht "Zellkern", "Funktion", "Kohlenstoff“ - Wörter, die in Biologie oder Chemie wichtig sind. Deshalb müssen auch Fachlehrer lernen, wie sie Sprache im Unterricht unterstützen. Ein Mathematiklehrer kann z.B. eine Formel nicht nur aufschreiben, sondern auch mit Bildern, Gesten und einfachen Sätzen erklären. Das ist keine Extraarbeit - das ist guter Unterricht.
Eltern spielen auch eine Rolle. Viele Eltern sprechen kein Deutsch und wissen nicht, wie sie ihren Kindern helfen können. Deshalb empfiehlt die KMK Elternkurse - wo man lernt, wie man mit der Schule kommuniziert, wie man Hausaufgaben unterstützt, wie man mit Lehrern spricht. In einigen Schulen gibt es schon solche Kurse - oft mit Übersetzerinnen und Übersetzern, die die Sprachbarriere überwinden.

Was bleibt zu tun? Kritik und Zukunftsperspektiven
Nicht alles läuft perfekt. Kritiker warnen: Wenn Kinder zu lange in separaten Klassen bleiben, entsteht soziale Isolation. Sie haben keine Freunde aus der Klasse, fühlen sich als "andere“, werden ausgegrenzt. Die räumliche Trennung muss durch regelmäßige gemeinsame Aktivitäten ausgeglichen werden - gemeinsame Pausen, Projekte, Schulveranstaltungen.
Auch die Lehrer müssen besser ausgebildet sein. Viele haben keine spezielle Ausbildung für Deutsch als Zweitsprache. Sie lernen es im Laufe der Zeit - aber das ist zu spät. Es braucht mehr Fortbildung, mehr Unterstützung, mehr Personal.
Und dann ist da noch die Datenlage. Die Hamburger PISA-Studie von 2018 zeigte: Schüler mit Migrationshintergrund haben im Lesen durchschnittlich 34 Punkte weniger als deutsche Schüler. Das ist kein kleiner Unterschied - das ist ein Bildungsrisiko. Wer hier nicht eingreift, verschärft soziale Ungleichheit.
Die Zukunft liegt in einer durchgängigen Sprachbildung. Sprachförderung darf nicht nur ein Jahr dauern - sie muss bis zur 9. Klasse reichen. Es geht nicht darum, Kinder zu "deutsch zu machen“, sondern sie zu befähigen, in der deutschen Gesellschaft erfolgreich zu sein. Und das bedeutet: Sprache als Werkzeug - nicht als Barrier.
Was passiert, wenn es nicht funktioniert?
Wenn Kinder nicht rechtzeitig Deutsch lernen, bleiben sie zurück. Sie können den Unterricht nicht folgen, verlieren das Interesse, werden unruhig oder schweigen. Viele verlassen die Schule ohne Abschluss. Das ist nicht nur ein Verlust für sie - es ist ein Verlust für die gesamte Gesellschaft. Wer nicht lesen und schreiben kann, hat später weniger Chancen auf Ausbildung, Arbeit, Teilhabe.
Die gute Nachricht: Es gibt Lösungen. Sprachförderklassen funktionieren - wenn sie richtig gemacht werden. Wenn sie früh beginnen, wenn sie individuell sind, wenn sie nicht isolieren, sondern verbinden. Wenn sie nicht nur Sprache lehren, sondern auch Zugehörigkeit schaffen.







10 Kommentare
Lutz Herzog
Das ist alles nur eine Umverteilungspolitik. Wer zahlt das? Die Steuerzahler, die selbst ums Überleben kämpfen. Sprachförderklassen? Klingt nett, aber es ist ein schwarzes Loch. Jedes Jahr mehr Geld, weniger Ergebnisse. Und dann kommt noch der ganze Kulturwandel dazu. Kein Wunder, dass die deutschen Kinder in Mathe und Deutsch abgehängt werden. Man sollte erst mal die eigenen Leute unterstützen, bevor man ganze Nationen hier integriert. 🤷♂️
Silje Løkstad
OMG this is such a classic case of institutionalized linguistic colonialism 😔
They’re not learning German-they’re being assimilated into a neoliberal pedagogical machine. The curriculum is coded with hegemonic norms: "Pausenglocke" as a symbol of discipline, "sich melden" as obedience training. And don’t even get me started on the "Zellkern"-vocabulary-as-power dynamic. We need decolonial pedagogy, not DeutschPLUS. 🌍💔
Nga Hoang
Was für eine Verschwendung! Wir haben hier Schulen, die fast zusammenbrechen, und jetzt sollen wir noch Kinder aus Kriegsgebieten extra fördern? Wer hat das beschlossen? Die Linken? Die Grünen? Ich hab doch auch Kinder, die in der Schule hungern, weil die Mittel fehlen. Sprachförderklasse? Ich sag: erstmal Deutsch lernen, dann kommen wir ins Regelklassenzimmer. Sonst wird Deutschland zum Sprachkurs-Land. Und nein, ich bin kein Rassist. Ich bin nur realistisch.
Kyle Kraemer
Ich hab das gelesen. Hab mir gedacht: okay, cool. Dann hab ich weitergeguckt. Und jetzt frag ich mich: wieso ist das immer noch ein Thema? Das ist doch Standard. Jedes Land macht das. Warum wird das hier so dramatisch dargestellt? Ich meine, es gibt doch sogar Lehrer, die das schon seit 20 Jahren machen. Kein Grund, das als Revolution zu verkaufen. Einfach machen. Und aufhören, darüber zu reden.
Susanne Lübcke
Ich hab mal in einer Sprachförderklasse gearbeitet. Da war ein Junge aus Syrien, 12 Jahre, hat nie einen Stift in der Hand gehabt. Nach drei Monaten hat er mir ein Gedicht geschrieben. Nicht perfekt. Aber echt. Und da hab ich verstanden: Sprache ist nicht nur Wortschatz. Das ist die erste Brücke aus der Einsamkeit. Ich weine immer noch, wenn ich daran denke. 😢
Wir machen hier keine Integration. Wir machen Menschlichkeit.
karla S.G
Ich hab’s gelesen. Und ich sag nur: Wer das nicht versteht, hat keine Ahnung vom deutschen Bildungswesen. Die Kids kriegen doch nicht mal die Grundlagen. Und dann sollen sie in Mathe mitmachen? Nein. Die müssen erst mal die Grundlagen haben. Und wer meint, das sei zu viel Aufwand, der soll mal versuchen, ohne Deutsch durch die Schule zu kommen. Ich hab das selbst erlebt. Meine Tochter hat ein Jahr gebraucht, um "Klassenarbeit" zu verstehen. Und das war mit Muttersprache Deutsch. Also haltet die Klappe, wenn ihr keine Ahnung habt.
Stefan Lohr
Der Text ist inhaltlich gut, aber grammatikalisch ungenau. Mehrfach fehlt das Komma vor Nebensätzen, "wenn sie sie brauchen" ist unklar, und "Zellkern" wird nicht korrekt als Substantiv behandelt. Außerdem: "DeutschPLUS" sollte in Anführungszeichen stehen, wenn es ein Eigenname ist. Und warum steht "Pausenglocke" nicht großgeschrieben? Das ist nicht nur stilistisch schlecht - das ist pädagogisch gefährlich. Wer so schreibt, vermittelt falsche Normen. Und das ist das eigentliche Problem.
Elin Lim
Sprache ist Macht. Und Macht ist nicht fair.
Die Schule lehrt nicht Deutsch.
Die Schule lehrt Gehorsam.
Und wer nicht mitspielt, bleibt draußen.
INGEBORG RIEDMAIER
Die hier dargestellten Konzepte entsprechen in hohem Maße den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Sprachbildung als Querschnittsaufgabe. Die schrittweise Integration unter Berücksichtigung der individuellen Lernvoraussetzungen stellt einen evidenzbasierten Ansatz dar, der sich an den Prinzipien der inklusiven Pädagogik orientiert. Besonders hervorzuheben ist die fachsprachliche Förderung in den regulären Fächern, welche eine kognitive und linguistische Differenzierung ermöglicht. Eine systematische Evaluation der Modelle wie "DeutschPLUS" und "SPRINT" wäre wünschenswert, um die Transferfähigkeit auf andere Bundesländer zu gewährleisten. Die Beteiligung von Eltern über strukturierte Kommunikationsformate stellt einen entscheidenden Faktor für den langfristigen Erfolg dar.
Koen Punt
Interessant, dass hier von "Integration" gesprochen wird, als wäre es ein Ziel - aber niemand fragt, wer hier eigentlich integriert wird. Die Kinder? Oder die deutsche Gesellschaft, die sich weigert, ihre eigenen Vorurteile zu dekonstruieren? Die Sprachförderklassen sind kein Bildungsprojekt. Sie sind ein Symbol für die Verweigerung des Dialogs. Wir geben den Kindern Deutsch, aber nicht den Raum, ihre eigene Sprache zu bewahren. Und dann wundern wir uns, dass sie sich nicht zugehörig fühlen. Das ist keine Integration. Das ist kulturelle Enteignung.