Sprachkompetenz-Check für Grundschulen
Willkommen zum Sprachkompetenz-Check
Dieses Tool hilft Ihnen, Ihre Schule oder Klasse bei der Umsetzung der sprachsensiblen Bildung nach dem Lehrplan 2023 zu bewerten. Beantworten Sie die Fragen zu den fünf Bausteinen des österreichischen Sprachkonzepts und erhalten Sie einen individuellen Handlungsempfehlungen.
1. Sprachsensibler Fachunterricht
2. Erst- und Zweitsprache
3. Sprachförderdiagnostik
4. Professionalisierung der Lehrkräfte
5. Evaluierung und Weiterentwicklung
In den letzten Jahren hat das österreichische Bildungssystem einen klaren Fokus auf die Sprachliche Bildung gelegt - vor allem in der Grundschule, wo die Grundlagen für lebenslanges Lernen gelegt werden. Der Lehrplan 2023 macht sprachsensiblen Unterricht zur Pflicht in allen Fächern und fordert von Lehrkräften, dass sie gezielt an der Entwicklung von Alltags‑, Bildungs‑ und Fachsprache arbeiten. Dieser Artikel erklärt, was der aktuelle Lehrplan beinhaltet, wie die fünf Bausteine praktisch umgesetzt werden und welche Hindernisse Lehrkräfte im Schulalltag noch bewältigen müssen.
Was bedeutet Sprachliche Bildung ein übergreifendes Lehrplanthema, das sprachliche Kompetenzen in allen Unterrichtsfächern systematisch fördert?
Das Bundesministerium für Bildung (BMB) definiert Sprachbildung als Schlüssel zur Bildungsgerechtigkeit: Wer sicher in Alltags‑ und Bildungssprache kommunizieren kann, hat bessere Chancen, später eine Ausbildung zu absolvieren. Seit dem Inkrafttreten des Lehrplans 2023 gilt die Förderung von Sprachkompetenzen nicht mehr nur im Deutschunterricht, sondern in Mathematik, Sachunterricht und sogar im Kunstfach.
Die fünf Bausteine des österreichischen Modells
Das ÖSZ‑Praxisheft 31 fasst die wichtigsten Handlungsfelder zusammen. Sie dienen als Leitfaden für jede Grundschule, die ein ganzheitliches Sprachkonzept etablieren will:
- Sprachsensibler Fachunterricht: Jede Fachstunde enthält sprachfördernde Elemente.
- Erst‑ und Zweitsprache: Integration von DaZ‑Klassen und freiwilligem Erstsprachenunterricht.
- Sprachförderdiagnostik: Frühzeitige Erfassung von Förderbedarf.
- Professionalisierung der Lehrkräfte: Fortbildungen zu sprachsensiblen Methoden.
- Evaluierung und Weiterentwicklung: Regelmäßige Reflexion des Sprachkonzepts.
Studien des Bundesinstituts für Bildungsforschung (BIF) zeigen, dass Schulen, die alle fünf Bausteine umsetzen, eine um 22 % höhere Bildungsgerechtigkeitsquote erreichen.
Lehrplan 2023 - Struktur und Kerninhalte
Der aktuelle Lehrplan gliedert den Deutschunterricht in sechs Teilbereiche: Sprechen, Lesen, Schreiben, Verfassen von Texten, Rechtschreiben und Sprachbetrachtung. Jeder Bereich verfolgt das Ziel, bildungssprachliche Kompetenzen aufzubauen, die später in Fachsprachen übertragbar sind.
Ein zentraler Paragraph lautet (BMB, 2023): "Lehrpersonen agieren als Sprachvorbilder, achten auf ihre Ausdrucksweise und nutzen unterschiedliche didaktische Methoden und Aufgabenformate." Damit wird von allen Lehrkräften verlangt, bereits im 1. Schuljahr bewusst auf Wortwahl, Satzstruktur und Fachterminologie zu achten.
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) - drei Settings im Überblick
| Setting | Zielgruppe | Verpflichtung | Schwerpunkt |
|---|---|---|---|
| Deutschförderklasse | Schüler*innen mit Förderbedarf | seit 2019 | Intensivsprachförderung, kleine Klassen |
| Deutschförderkurs (außerordentlich) | Schüler*innen mit starkem Förderbedarf | seit 2023 | Individualisierte Lernpläne, zusätzliche Ressourcen |
| Deutschförderkurs (ordentlich) | Reguläre Klassen | seit 2023 | Integration von Sprachförderung in Fachunterricht |
| Erstsprachenunterricht | Alle Schüler*innen | unverbindlich | Stärkung von Muttersprache, Identitätsbildung |
Die DaZ‑Lehrpläne sind als Teil des Gesamtkonzepts Sprachliche Bildung konzipiert. Der BMB betont, dass idealerweise alle Fachlehrkräfte mit den DaZ‑Lehrkräften kooperieren, um ein durchgängiges Sprachfördernetz zu schaffen.
Praxisbeispiele aus Österreich
Verschiedene Schulen haben bereits konkrete Erfolge gemeldet:
- Grundschule am Schlossberg, Graz: Durch die Einführung der fünf Bausteine über zwei Jahre stieg die Lesekompetenz von mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern um 18 Prozentpunkte (BIMM‑Plattform, 2023).
- Volksschule Innsbruck‑West: Kritik an fehlender Zeit und Personal für fächerübergreifende Sprachförderung (interner Bericht, 2023).
- Lehrer‑Online‑Bewertung: Das Praxisheft 31 erhielt 4,7 von 5 Sternen (87 Bewertungen), weil es klare Aufgabenbeispiele und Materialsammlungen bietet.
Eine Umfrage des Österreichischen Lehrerforums (Februar 2023) zeigte, dass 78 % die Bedeutung des Themas anerkennen, aber nur 43 % sich ausreichend vorbereitet fühlen - ein Hinweis darauf, dass Fortbildung und Materialbereitstellung noch ausgebaut werden müssen.

Kompetenzen, die Lehrkräfte benötigen
Im Bachelor‑Lehramt-Studium (z. B. Pädagogische Hochschule Wien) gibt es seit 2019 das Modul „Sprachliche Bildung - Schuleingangsphase“ (5 ECTS). Dort lernen angehende Lehrkräfte, sprachsensiblen Unterricht zu planen, diagnostische Verfahren anzuwenden und fächerübergreifende Lernaufgaben zu entwickeln.
Die Plattform „Paedagogik‑Paket“ listet 27 Fortbildungsangebote. Der Kurs „Sprachsensibler Fachunterricht in Mathematik“ (15 UE, 120 Euro) wurde im Schuljahr 2022/23 von 1 842 Lehrkräften besucht - ein Hinweis, dass Fachlehrkräfte zunehmend Interesse zeigen.
Digitalisierung als neuer Motor
Die Verordnung vom 15. Jänner 2024 führte den „Digitalen Sprachbildungsordner“ ein. Dieses Online‑Tool bietet adaptive Lernpfade für mehrsprachige Kinder und ermöglicht Lehrkräften, Lernfortschritte in Echtzeit zu überprüfen. Erste Pilotprojekte in Wiener Grundschulen zeigen, dass digitale Übungen die Leseflüssigkeit um durchschnittlich 12 % verbessern.
Künftig soll das Schulunterrichtsgesetz (geplante Novellierung Herbst 2024) die jährliche Evaluation der Sprachbildung verpflichtend machen - ein Schritt, der mehr Transparenz und Datenbasis für Politik und Schulen schaffen wird.
Herausforderungen und Lösungsansätze
Die wichtigsten Stolpersteine laut Umfrage 2023:
- Fehlende Zeit für Vorbereitung (68 %).
- Unzureichende Fortbildungsangebote (59 %).
- Mangel an Materialien für fächerübergreifende Förderung (52 %).
Zur Bewältigung gibt es bereits bewährte Strategien:
- Teamteaching: Fachlehrkräfte planen gemeinsam Sprachziele für jede Einheit.
- Coaching‑Programme der Bildungsdirektionen: 85 % der teilnehmenden Schulen bewerten das Coaching als „sehr gut“ bis „gut“ (Evaluation Wien, 2022).
- Materialbibliothek ÖSZ: Kostenlose PDFs, Unterrichtssequenzen und Checklisten, die sofort im Unterricht einsetzbar sind.
Finanzierung bleibt kritisch. Das Bundesbudget 2024 erhöht den Etat für Erstsprachenunterricht nur um 2,3 %, während die Zahl mehrsprachiger Schüler*innen um 4,7 % steigt (Statistik Austria, 2024). Experten fordern eine gezielte Mittelzuweisung, um die wachsende Nachfrage zu decken.
Ausblick bis 2026
Laut BIFIE‑Prognose wird der Anteil der Schulen mit etabliertem Sprachkonzept von derzeit 38 % auf 65 % steigen. Das bedeutet, dass fast zwei Drittel aller Grundschulen ein strukturiertes, fächerübergreifendes Sprachförderprogramm laufen haben werden. Wenn die geplanten Gesetzesänderungen und die digitale Infrastruktur vollständig umgesetzt sind, sollen die schulischen Übergänge - besonders von 4. zu 5. Klasse - deutlich flüssiger werden.
Kurzer Überblick - Was Sie jetzt tun können
- Lesen Sie das ÖSZ‑Praxisheft 31 und erstellen Sie ein erstes Sprachförder‑Check‑list für Ihr Fach.
- Melden Sie sich für mindestens eine Fortbildung im Bereich sprachsensibler Fachunterricht an (z. B. Mathematik‑Modul).
- Implementieren Sie digitale Tools wie den Digitalen Sprachbildungsordner, um Lernfortschritte messbar zu machen.
- Organisieren Sie ein Team‑Meeting mit Fachlehrkräften, um gemeinsame Sprachziele zu definieren.
- Nutzen Sie die Coaching‑Programme Ihrer Bildungsdirektion, um externe Expertise zu erhalten.

Wie definiert das BMB „sprachsensiblen Unterricht“?
Der Begriff bezeichnet eine Unterrichtsgestaltung, die in allen Unterrichtsgegenständen stattfindet und den schrittweisen, altersadäquaten und kontinuierlichen Aufbau von Kompetenzen in der Alltags-, Bildungs‑ und Fachsprache fördert.
Welche fünf Bausteine gehören zum österreichischen Sprachkonzept?
Sprachsensibler Fachunterricht, Erst‑ und Zweitsprache, Sprachförderdiagnostik, Professionalisierung der Lehrkräfte und Evaluierung/Weiterentwicklung.
Wie kann ich als Grundschullehrkraft die fünf Bausteine praktisch umsetzen?
Starten Sie mit einer Bestandsaufnahme der Sprachkompetenzen Ihrer Klasse, entwickeln Sie gemeinsam mit Fachkollegen sprachfördernde Lernziele, nutzen Sie ÖSZ‑Materialien für fächerübergreifende Aufgaben und planen Sie regelmäßige Reflexionen und Anpassungen des Konzepts.
Welche digitalen Hilfsmittel unterstützen die Sprachbildung?
Der Digitale Sprachbildungsordner, adaptive Lernplattformen wie LearningApps, sowie schulinterne Lernmanagementsysteme, die Lernfortschritte in Lese‑ und Schreibkompetenz visualisieren, sind besonders wertvoll.
Wo finde ich Fortbildungen zum Thema sprachsensibler Unterricht?
Auf der Plattform Paedagogik‑Paket des BMB gibt es ein umfangreiches Angebot; zudem bieten die Pädagogischen Hochschulen regelmäßig Seminare zu DaZ, Erstsprachenunterricht und fächerübergreifender Sprachförderung an.



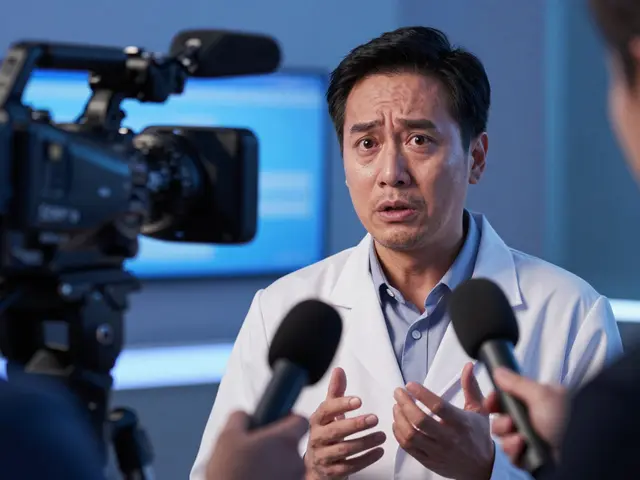

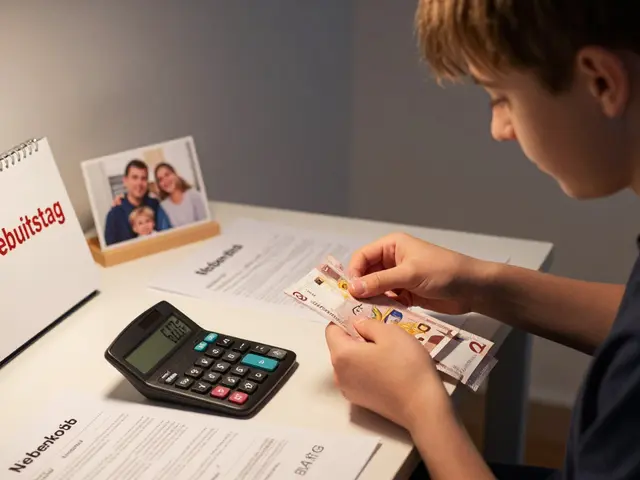

11 Kommentare
Nessi Schulz
Die aktuelle Umsetzung des Lehrplans 2023 ist ein bedeutender Schritt hin zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Durch die systematische Einbindung von Sprachförderung in allen Fächern wird die Grundlage für lebenslanges Lernen gestärkt. Besonders hervorzuheben ist die klare Vorgabe, dass Lehrkräfte als Sprachvorbilder agieren und ihre Ausdrucksweise reflektieren. Die fünf Bausteine bieten einen strukturierten Rahmen, der sowohl für DaZ‑Klassen als auch für reguläre Klassen funktioniert. Ein zentrales Element ist die frühzeitige Sprachförderdiagnostik, die es ermöglicht, gezielt Förderbedarf zu identifizieren und zu adressieren. Insgesamt zeigt das Konzept, dass ein ganzheitlicher Ansatz langfristig die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler nachhaltig verbessert.
Steffi Hill
Klasse, das gibt echt Hoffnung.
Christian Torrealba
Das Praxisheft 31 ist praktisch ein Goldschatz für Lehrkräfte. Es liefert sofort einsetzbare Materialien und Checklisten, die das tägliche Unterrichten erleichtern. Gerade für neue Lehrkräfte ist das ein enormer Vorteil, weil sie nicht alles selbst erfinden müssen. 📚 Die Kombination aus Theorie und Praxisbeispielen macht den Unterschied. Wer regelmäßig die Materialien nutzt, berichtet von deutlich besseren Lernergebnissen im Fach Deutsch und darüber hinaus.
Torolf Bjoerklund
Man könnte meinen, dass die neue Gesetzeslage das Problem löst, aber ohne ausreichende Finanzierung bleibt alles nur ein schönes Gerede. 🙄 Viele Schulen kämpfen bereits jetzt mit Personalengpässen, und das wird sich nicht von selbst ändern.
Stefan Johansson
Ach wirklich, man soll also jetzt jedem Unterricht ein bisschen Wortschatz hinzufügen, damit die Schüler*innen besser kommunizieren können? Klingt nach einer brillanten Idee, bis man merkt, dass das die bereits überlasteten Lehrkräfte noch mehr belastet. Statt neue Aufgaben zu schaffen, sollten wir lieber die bestehenden Ressourcen optimieren – das heißt, weniger Bürokratie und mehr echte Zeit im Klassenzimmer. Wie soll ein Lehrer in einer 45‑Minuten‑Stunde sowohl Mathe erklären, ein Experiment durchführen als auch noch die korrekte Fachsprache trainieren? Das ist kaum machbar, wenn man bedenkt, dass viele noch keine Grundausstattung haben. Die Forderung nach mehr Fortbildungen klingt zwar gut, aber wenn die Schultage bereits bis zum Abgrund gehen, bleibt keine Energie für zusätzliche Workshops. Und dann die angebliche „digitale Sprachbildungsplattform“ – ja, super, solange das WLAN stabil ist und die Geräte funktionieren. In vielen ländlichen Regionen fehlt das überhaupt. Man könnte fast sagen, die Politik spielt hier ein verrücktes Spiel mit den Lehrkräften, das eher ein Streich ist als ein echter Reformversuch. Weil jeder weiß, dass das Wort „Sprachsensibilität“ viel schöner klingt als das Wort „Zusatzbelastung“. Kurz gesagt, wir brauchen realistische Ziele, nicht nur schöne Worte, die dann in den allerletzten Momenten des Schuljahres vergessen werden.
Christoffer Sundby
Ein unterstützendes Coaching-Programm kann tatsächlich die Brücke zwischen Theorie und Praxis schlagen. Durch gezielte Begleitung erhalten Lehrkräfte Rückmeldung zu ihrer Umsetzung und können gemeinsam Lösungen entwickeln. Dabei ist es wichtig, dass die Coaches selbst mit dem Konzept vertraut sind und praxisnahe Tipps geben.
Jamie Baeyens
Die philosophische Tiefe dieses Ansatzes erinnert an ein Kaleidoskop aus sprachlichen Facetten, das uns ständig neue Muster präsentiert. Es ist, als würde man in einen Ozean aus Worten eintauchen, wobei jeder Tropfen ein neues Lernpotential birgt. Die Farbigkeit der Methodik macht das Ganze zu einem wahren Fest für die Sinne.
Erwin Vallespin
Wow, das klingt echt nach einem bunten Zirkus der Sprachen! Ich glaub, ich hab da schonmal was ähnliches gesehn, aber die Idee, dass jedes Fach ein Sprachlabyrinth trägt, ist einfach nur spitze. Man muss nur darauf achten, dass die Lehrer nich zu sehr im Labyrinth verirrt werden, sonst klappt nix. Trotzdem, das ist definitiv ein Schritt in die richtriche Richtung. Wer weiß, vielleicht wird das ja nochmal überarbeitet und perfektioniert.
Christian Suter
Im Hinblick auf die vorliegende Lehrplanrevision ist es unabdingbar, die strukturellen Rahmenbedingungen zu prüfen und entsprechende Ressourcen zu allokieren. Eine konsequente Implementierung erfordert sowohl institutionelle Unterstützung als auch kontinuierliche Evaluation.
Lutz Herzog
Ich habe da mal was gelesen, dass das Ganze nur ein Ablenkungsmanöver ist, um von den eigentlichen Problemen im Bildungssystem abzulenken. Immer diese angeblichen Innovationen, die nie wirklich funktionieren, weil die wahren Machenschaften im Hintergrund laufen. Man muss da kritisch bleiben und nicht alles hinnehmen, was da nach außen gepfeffert wird.
Silje Løkstad
Die aktuelle Diskussion um sprachsensiblen Unterricht ist voll von Buzzwords und pseudo‑wissenschaftlichen Konzepten, die kaum messbare Effekte zeigen. Es fehlt an klaren KPIs, und das ganze Gerede wirkt wie ein Marketing‑Trick, um Fördermittel zu kanalisieren. 🤔