Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland: Wie Forschung wirklich gefördert wird
Im Jahr 2025 bekommen Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland mehr Geld als je zuvor - aber immer noch viel zu wenig im Vergleich zu ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Während Ingenieurwissenschaften knapp ein Drittel aller öffentlichen Forschungsmittel abbekommen, entfallen auf die Geistes- und Sozialwissenschaften (GSW) nur 8,7 %. Das ist kein technisches Problem. Es ist ein Wahrnehmungsproblem. Wer glaubt, dass Texte, Geschichte, Gesellschaftsstrukturen oder Kultur keine Rolle in einer digitalisierten, krisengeschüttelten Welt spielen, der versteht nicht, wie Gesellschaften funktionieren - oder wie sie überleben.
Die Bundesregierung hat das erkannt. Seit 2019 läuft das Rahmenprogramm Gesellschaft verstehen - Zukunft gestalten des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR). Es ist das größte und strukturierteste Förderinstrument für GSW in Deutschland. Bis 2025 wurden über 400 Projekte unterstützt - von der digitalen Erforschung von DDR-Alltagskultur bis zur Analyse von Radikalisierungsprozessen. Die letzte Einreichungsfrist für neue Projekte ist der 30. November 2025. Danach wird das Programm verlängert, wie im Koalitionsvertrag der Bundesregierung 2025 festgehalten. Das ist kein Zufall. Es ist eine Antwort auf die Krise der gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Wie viel Geld fließt wirklich - und wohin?
Das Fördervolumen für Geistes- und Sozialwissenschaften liegt 2025 bei rund 487 Millionen Euro jährlich. Klingt viel? Ist es auch - wenn man bedenkt, dass es vor zehn Jahren noch halb so viel war. Aber im Vergleich zu anderen Disziplinen ist es knapp. Die DFG verteilt 29,8 % der GSW-Mittel, das BMFTR 42,3 %. Die Bundesländer kommen auf 18,5 %, Stiftungen auf 9,4 %. Das bedeutet: Die größten Förderer sind staatlich. Und das ist gut so - denn private Geldgeber haben oft andere Prioritäten.
Die Förderhöhen variieren stark. Ein typisches BMFTR-Projekt erhält bis zu 500.000 Euro für drei bis fünf Jahre. Die DFG-Kolleg-Forschungsgruppen gehen noch weiter: bis zu acht Jahre, mit einem Budget von mehr als einer Million Euro. Das ist ein Luxus, den andere Disziplinen selten haben. Die Daimler und Benz Stiftung fördert dreijährige Projekte mit bis zu 1,5 Millionen Euro - aber nur, wenn sie sich mit KI und menschlicher Erfahrung beschäftigen. Und die Karg-Stiftung zahlt Spitzenpreise von 25.000 Euro für Forschung zu Begabungsgerechtigkeit - aber nur, wenn die Projekte interdisziplinär sind.
Im Gegensatz dazu gibt es Programme wie das NRW-Landesprogramm, das Nachwuchswissenschaftler*innen bis sechs Jahre nach der Promotion mit 35.000 bis 70.000 Euro unterstützt. Das ist kein Millionengeschäft - aber es ist lebenswichtig. Denn viele Geisteswissenschaftler*innen starten ihre Karriere mit einem befristeten Vertrag, ohne eigene Mittel. Diese Programme sind ihre Rettungsleine.
Warum sind Anträge so schwer zu schreiben?
Ein guter Antrag für ein GSW-Projekt braucht zwischen 120 und 150 Arbeitsstunden. Das ist nicht übertrieben. Die Universität Bielefeld hat das in einer Analyse 2025 bestätigt. Warum so viel? Weil die Anforderungen komplex sind. Die meisten Förderer verlangen eine zweistufige Bewerbung: Zuerst eine Skizze, dann ein vollständiger Antrag. Und der muss nicht nur wissenschaftlich überzeugen - er muss auch zeigen, wie die Forschung gesellschaftlich wirkt.
Das ist neu. Früher reichte es, eine gute Frage zu stellen. Heute muss man erklären, warum diese Frage wichtig ist - für die Demokratie, für den Umgang mit KI, für den Umgang mit Migration. Die BMFTR-Förderlinie zur DDR-Forschung etwa verlangt explizit, dass die Ergebnisse in Schulen, Museen oder Medien einfließen. Die DFG will nicht nur neue Erkenntnisse, sondern auch neue Formate: Podcasts, digitale Archive, interaktive Karten.
Und dann ist da noch die Konkurrenz. Die Durchwahrscheinlichkeit für GSW-Projekte bei der DFG liegt bei 28,7 %. Für Naturwissenschaften sind es 35,2 %. Das ist kein Zufall. Die Bewertungskriterien sind oft auf quantifizierbare Ergebnisse ausgerichtet. Ein Projekt zur „Digitalen Edition historischer Texte“ wurde abgelehnt - mit der Begründung: „Fehlende Innovationskraft im Vergleich zu naturwissenschaftlichen Projekten“. Das ist kein Urteil über die Qualität der Arbeit. Das ist ein Urteil über ein System, das noch immer MINT als Maßstab setzt.

Die Sichtbarkeitskrise: Warum niemand von Ihrer Forschung hört
Die meisten Geisteswissenschaftler*innen arbeiten im Stillen. Ihre Ergebnisse erscheinen in Fachzeitschriften, die von wenigen hundert Menschen gelesen werden. Die Öffentlichkeit bekommt sie nicht mit. Eine Umfrage der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft (DVPW) aus März 2025 zeigt: 68,4 % der Befragten halten die Sichtbarkeit ihrer Forschung für problematisch. 74,2 % kritisieren die Komplexität der Antragsverfahren. Und doch: Es gibt Lichtblicke.
Das BMFTR-Programm „Kulturerbe als Resource für eine zukunftsfähige Gesellschaft“ hat gezeigt, dass Geschichte und Kultur nicht nur für Akademiker interessant sind. Projekte zur Restaurierung von DDR-Plakaten, zur digitalen Rekonstruktion von jüdischen Friedhöfen oder zur Erforschung von Migrationsgeschichten in ländlichen Regionen haben in lokalen Medien, Schulen und sogar in Fernsehdokumentationen Aufmerksamkeit gefunden. Die Forschung wird sichtbar - wenn sie konkret ist.
Die Karg-Stiftung hat einen anderen Weg gewählt: Sie zahlt Preise für Forschung, die direkt mit Technik und Gesellschaft verknüpft ist. Wer über KI und Bildung forscht, wer über digitale Ungleichheit schreibt, wer die Auswirkungen von Algorithmen auf Kinder analysiert - der bekommt nicht nur Geld, sondern auch Aufmerksamkeit. Die Jury besteht aus Expert*innen aus Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik. Das ist kein Zufall. Es ist ein Signal: Die Zukunft gehört interdisziplinären Lösungen.
Internationalisierung: Die Chance, die Deutschland verpasst
Deutschland ist kein isolierter Forschungsstandort. Die internationale Zusammenarbeit ist der Schlüssel zur Sichtbarkeit. Das ANR-DFG-Programm für deutsch-französische Projekte ist in 2025 in der 19. Runde. Keine thematischen Vorgaben. Durchschnittlich 450.000 Euro pro Projekt. Die Erfolgsquote liegt bei 36,2 % - höher als bei nationalen Programmen. Warum? Weil internationale Teams mehr Perspektiven haben. Weil sie besser argumentieren können. Weil sie nicht nur für Deutschland, sondern für Europa forschen.
Die deutsch-italienische Zusammenarbeit hingegen ist eng begrenzt. Sie fokussiert sich nur auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen - wie Migration oder soziale Spaltung. Das ist sinnvoll, aber begrenzt. Die britisch-deutsche Initiative AHRC-DFG läuft gerade im achten Durchgang. Und ab 2028 kommt FP10, das neue EU-Rahmenprogramm, mit einem eigenen Kapitel für Sozial- und Geisteswissenschaften. Eine Veranstaltung am 10. Dezember 2025 in Brüssel wird die Details vorstellen. Wer jetzt nicht mitmacht, verpasst die nächste große Welle.

Was bleibt - und was muss sich ändern?
Die Förderlandschaft für Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland ist vielfältig. Sie ist komplex. Sie ist ungleich. Aber sie ist da. Und sie wächst. Die Bundesregierung hat angekündigt, die Mittel bis 2027 um 22 % zu erhöhen. Das ist historisch. Die Akademienförderung mit 12-jährigen Projektlaufzeiten ist weltweit einzigartig. Die DFG hat neue Formate für Nachwuchswissenschaftler*innen eingeführt. Die Stiftungen experimentieren mit interdisziplinären Ansätzen.
Doch die Probleme bleiben: Die Unterfinanzierung im Verhältnis zur Lehre. Die Diskriminierung gegenüber MINT-Fächern. Die Fragmentierung der Förderinstrumente. Die hohe Antragslast für Nachwuchswissenschaftler*innen. Und die fehlende Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit.
Prof. Dr. Cornelia Siebeck von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie sagt es klar: „Wir decken 28 % der universitären Lehre ab, bekommen aber nur 5,3 % der DFG-Mittel.“ Das ist kein Fehler. Das ist ein Systemversagen. Der Wissenschaftsrat hat 2025 empfohlen, die institutionelle Grundfinanzierung für geisteswissenschaftliche Institute um 15 % bis 2027 zu erhöhen. Das ist kein Luxus. Das ist eine Notwendigkeit.
Die Zukunft der Geistes- und Sozialwissenschaften liegt nicht in mehr Anträgen. Sie liegt in mehr Vertrauen. In mehr langfristiger Finanzierung. In mehr öffentlicher Anerkennung. Wer die Gesellschaft verstehen will - wer sie verändern will - braucht sie. Nicht als Nebenfach. Nicht als Ergänzung. Sondern als Kern.
Was Forscher*innen jetzt tun können
- Prüfen Sie, ob Ihr Projekt in das BMFTR-Rahmenprogramm „Gesellschaft verstehen - Zukunft gestalten“ passt - die letzte Frist ist der 30. November 2025.
- Wenn Sie weniger als sechs Jahre nach der Promotion sind: Bewerben Sie sich beim NRW-Landesprogramm - Frist 30. Oktober 2025.
- Wenn Sie interdisziplinär arbeiten: Die Karg-Stiftung und die Daimler und Benz Stiftung haben Fristen im Oktober 2025 - nutzen Sie die Chance.
- Suchen Sie sich eine Beratungsstelle: Die Universitäten Erfurt und Köln bieten spezialisierte Förderberatung an. Die Anfragen steigen - weil es funktioniert.
- Denken Sie international: Bewerben Sie sich für ANR-DFG oder die Vorbereitung auf FP10. Die Erfolgsquote ist höher - und die Wirkung größer.
Die Geistes- und Sozialwissenschaften haben nicht nur Antworten auf die großen Fragen der Zeit. Sie haben auch die Werkzeuge, um sie zu finden. Jetzt muss nur noch jemand zuhören.
Wie hoch ist das Gesamtvolumen der Fördermittel für Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland 2025?
Das Gesamtvolumen beträgt rund 487 Millionen Euro jährlich. Davon stammen 42,3 % vom BMFTR, 29,8 % von der DFG, 18,5 % von den Bundesländern und 9,4 % von Stiftungen. Dies entspricht 8,7 % der gesamten öffentlichen Forschungsausgaben in Deutschland.
Welches ist das größte Förderprogramm für Geisteswissenschaften in Deutschland?
Das größte Programm ist das BMFTR-Rahmenprogramm „Gesellschaft verstehen - Zukunft gestalten“. Es wurde 2019 gestartet, läuft bis 2025 und wird verlängert. Es unterstützt über 400 Projekte mit einem Fokus auf gesellschaftliche Herausforderungen, Kulturerbe, Digitalisierung und internationale Zusammenarbeit.
Warum bekommen Geisteswissenschaften weniger Geld als Naturwissenschaften?
Weil das Forschungssystem traditionell auf messbare, quantifizierbare Ergebnisse ausgerichtet ist - wie Patente, Technologien oder klinische Studien. Geisteswissenschaftliche Forschung produziert oft qualitative Erkenntnisse, die schwerer zu bewerten sind. Das führt zu einer systematischen Unterschätzung, obwohl sie gesellschaftlich ebenso relevant ist - etwa bei Themen wie Demokratie, Migration oder Klimawandel.
Welche Förderung ist besonders für Nachwuchswissenschaftler*innen geeignet?
Das NRW-Landesprogramm „Forschung plus“ und „Impulse“ ist speziell für Forschende bis sechs Jahre nach der Promotion ausgelegt. Es bietet bis zu 70.000 Euro für Projekte an Fachhochschulen und Kunsthochschulen. Auch die DFG-Kolleg-Forschungsgruppen mit bis zu acht Jahren Laufzeit bieten eine stabile, langfristige Förderung ohne ständigen Antragsdruck.
Wie kann ich meine Forschung sichtbarer machen?
Verknüpfen Sie Ihre Forschung mit konkreten gesellschaftlichen Fragen - etwa durch Kooperationen mit Schulen, Museen oder Medien. Nutzen Sie digitale Formate wie Podcasts, digitale Archive oder interaktive Karten. Bewerben Sie sich für Förderprogramme, die gesellschaftlichen Impact verlangen, wie das BMFTR-Programm oder die Karg-Stiftung. Sichtbarkeit entsteht nicht durch Veröffentlichungen allein, sondern durch Anwendung und Dialog.
Wann startet das neue EU-Rahmenprogramm FP10 für Geistes- und Sozialwissenschaften?
FP10 startet im Jahr 2028. Eine wichtige Informationsveranstaltung zur Vorbereitung findet am 10. Dezember 2025 statt. Es ist das erste EU-Programm, das explizit Sozial- und Geisteswissenschaften als eigenständigen Bereich mit eigenen Förderschwerpunkten einbezieht - eine historische Chance für internationale Zusammenarbeit.



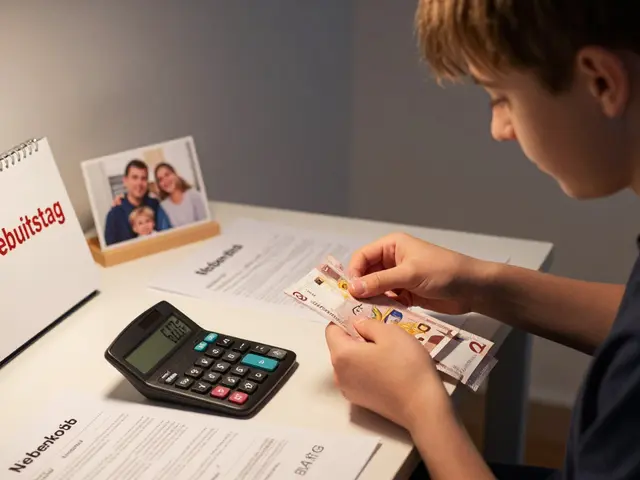
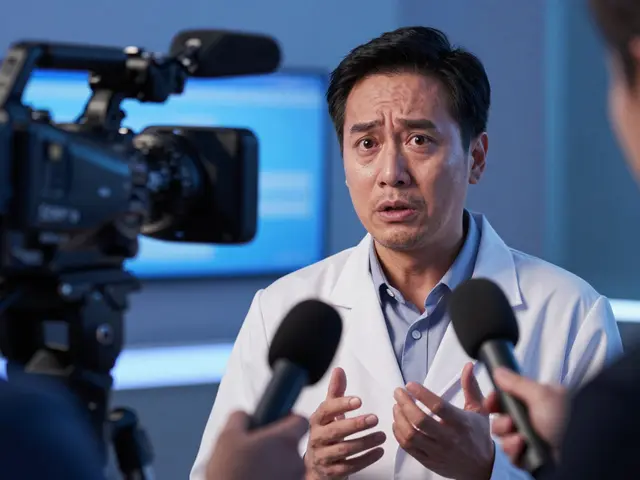


11 Kommentare
Kyle Kraemer
Also ich find's gut, dass endlich mehr Geld fließt, aber echt, wer schreibt noch so lange Texte? Ich hab' nen Antrag gemacht, hab' 3 Wochen gebraucht und dann kam die Absage mit 'keine Innovationskraft'. Ach ja, klar. Ich mach' lieber was anderes.
Susanne Lübcke
Manchmal frag ich mich, ob wir nicht alle nur in einem riesigen Gedächtnis-Spiel sitzen. Die Geschichte wird digitalisiert, die Kultur wird analysiert, aber wer hört wirklich zu? Ich hab' neulich nen Podcast über DDR-Plakate gemacht. 1200 Hörer. Und 11 davon waren Professoren. Das ist nicht Sichtbarkeit. Das ist Echo.
karla S.G
8,7 %? Das ist doch lächerlich! Wir brauchen mehr Ingenieure, nicht mehr Leute, die über Plakate schreiben. Wer soll denn die Welt reparieren? Die, die die Brücken bauen, oder die, die fragen, warum die Leute nicht mehr über Brücken reden? Ich find's peinlich, dass wir so viel Geld für Soziologie verschwenden, während die Schulen pleite sind.
Stefan Lohr
Die Antragslast ist tatsächlich absurd. 150 Arbeitsstunden für einen Antrag, der mit 71,3 % Wahrscheinlichkeit abgelehnt wird? Das ist kein System. Das ist ein Motivationskiller. Wer das noch macht, hat entweder zu viel Zeit oder zu wenig Selbstrespekt.
Elin Lim
Sichtbarkeit ist kein Ziel. Verständnis ist es.
INGEBORG RIEDMAIER
Die institutionelle Grundfinanzierung stellt eine strukturelle Voraussetzung für die langfristige Stabilität der geisteswissenschaftlichen Forschungslandschaft dar. Die derzeitige Förderarchitektur, geprägt durch projektorientierte, zeitlich begrenzte Mittel, führt zu einer Fragmentierung der Wissensproduktion und einer Subjektivierung der Forschungsagenda. Eine Erhöhung um 15 % bis 2027 ist nicht nur angemessen, sondern zwingend erforderlich.
Koen Punt
Interessant, dass hier von 'Sichtbarkeit' gesprochen wird, als wäre das ein quantifizierbares KPI. Aber wer definiert Sichtbarkeit? Die Medien? Die Politik? Die Stiftungen? Oder doch die akademische Gemeinschaft? Die DFG hat seit 2020 einen Impact-Index eingeführt, der aber nur 17 % der Bewertung ausmacht. Der Rest? Tradition. Und das ist das eigentliche Problem.
Harry Hausverstand
Ich hab' letztes Jahr nen kleinen Antrag für 'Digitale Rekonstruktion jüdischer Friedhöfe' eingereicht. Hab' 3 Monate gebraucht. Hab' mich mit Schülern unterhalten, mit Kirchengemeinden, mit Archiven. Kein einziger Professor hat was dazu gesagt. Aber als der Film im lokalen Fernsehen lief, kamen 200 Leute zum Vortrag. Das war mehr als jeder Impact-Report. Vielleicht sollte man einfach aufhören, den Forschern die ganze Last aufzubürden.
Stephan Lepage
das ist doch alles nur kulturkampf in antragsform irgendwann fragt sich doch jeder warum man sich das antut ich hab 3 jahre an nem projekt gesessen das hat 1,2 mio gekostet und keiner hat es gelesen außer meine kollegen und die haben es nur zitiert weil sie mussten
Erica Schwarz
Ich hab' neulich mit einer Schülerin geredet, die hat gesagt: 'Warum lernen wir Geschichte, wenn wir doch nur Daten auswendig lernen sollen?' Ich hab' ihr dann von einem Projekt erzählt, das digitale Tagebücher von Jugendlichen aus den 50ern online gestellt hat. Sie hat sich 2 Stunden reingeklickt. Und dann hat sie gesagt: 'Das ist, als würde man mit jemandem reden, der schon tot ist.' Das ist Sichtbarkeit. Nicht durch Budgets. Sondern durch Berührung.
Oliver Sy
Die Förderstrategie muss sich von projektbasiertem Opportunismus hin zu institutioneller Resilienz entwickeln. Die Einführung von DFG-Kolleg-Forschungsgruppen mit bis zu acht Jahren Laufzeit ist ein paradigmatischer Wendepunkt, der die kognitive Stabilität der Disziplin gewährleistet. Zusätzlich sollte die Integration von KI-gestützten Textanalysen in die Antragsbewertung priorisiert werden, um die Subjektivität humanistischer Evaluierung zu reduzieren. Die Karg-Stiftung demonstriert bereits erfolgreich, wie interdisziplinäre Synergien durch strukturierte Kooperationen entstehen. Wir stehen an einem historischen Threshold - und es ist Zeit, die Infrastruktur zu modernisieren. 🚀