Warum Klimakommunikation mit Schülern in Österreich nicht mehr nur um Wissen geht
Ein Schüler in Graz weiß, dass CO₂ die Erde erwärmt. Er hat es im Biologieunterricht gelernt, im Fernsehen gesehen, in sozialen Medien gelesen. Aber was tut er danach? Die meisten sagen: Ich will etwas ändern. Doch nur jeder Zweite macht tatsächlich etwas. Diese Kluft zwischen Wissen und Handeln ist der Kern der Klimakommunikation heute - und sie wird in Österreich mit einem klaren Ansatz angegangen: Handlungsorientierung.
Es reicht nicht mehr, den Klimawandel zu erklären. Schülerinnen und Schüler brauchen konkrete Wege, wie sie in ihrem Alltag, in ihrer Schule, in ihrer Familie etwas bewegen können. Und das funktioniert nur, wenn die Kommunikation nicht von oben herab kommt, sondern mit ihnen, von ihnen und für sie.
Wie funktioniert handlungsorientierte Klimakommunikation?
Handlungsorientierte Klimakommunikation bedeutet: Keine langen Vorträge, keine trockenen Diagramme, keine Angstmacherei. Stattdessen: Schülerinnen und Schüler werden zu Aktivisten in ihrem eigenen Umfeld. Sie messen den Stromverbrauch ihrer Schule, analysieren, wie ihre Mitschüler*innen zur Schule kommen, untersuchen, wie viel Müll in der Cafeteria entsteht - und dann ändern sie etwas.
Das Klimaschulen-Programm des Klima- und Energiefonds macht das mit der Initiative „Klimadedektiv:innen“ konkret. Schüler*innen werden zu Ermittler:innen ihrer eigenen Schule. Sie suchen nach Energieverschwendung, dokumentieren sie mit Fotos und Zahlen, und entwickeln Lösungen - wie z.B. Stromschalter mit Aufklebern, die sagen „Ausmachen spart!“ oder ein Fahrradparkplatz vor der Tür, statt nur einen Bus. Nach zwei Jahren haben 73 Prozent der teilnehmenden Schulen konkrete Maßnahmen umgesetzt. Nicht weil sie es von der Lehrkraft hören mussten, sondern weil sie es selbst beschlossen haben.
Was funktioniert wirklich - und was nicht?
Die Daten aus Österreich zeigen klar: Wenn Klimakommunikation nur informativ ist, bleibt sie wirkungslos. Eine Befragung von 300 Jugendlichen im AUTreach-Projekt ergab: Fast 40 Prozent fühlen sich schlecht informiert - nicht weil sie nichts wissen, sondern weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. 68 Prozent sagen: Sie fühlen sich überfordert.
Doch wenn die Kommunikation lebensnah, wertschätzend und konkret ist, ändert sich alles. Die Plattform „Hallo Klima!“ des Klima- und Energiefonds nutzt einfache Sprache, echte Geschichten von Jugendlichen und kleine, machbare Schritte: „Statt Flaschenwasser: Trinkwasser aus der Leitung.“ „Zwei Mal pro Woche fleischlos essen.“ „Mit dem Rad zur Schule, wenn es unter 5 Kilometer sind.“
Und die Wirkung? 82 Prozent der Schüler*innen, die diese Inhalte nutzen, fühlen sich motivierter, klimafreundlich zu handeln. Warum? Weil sie nicht nur lernen, dass der Klimawandel schlimm ist - sondern dass sie selbst etwas bewirken können. Und zwar sofort.

Die Rolle der Lehrkräfte - und warum sie oft scheitern
Lehrkräfte sind die Schlüsselakteure. 80 Prozent von ihnen halten handlungsorientierte Klimabildung für „wichtig bis sehr wichtig“. Doch 75 Prozent klagen über denselben Grund: Keine Zeit im Lehrplan, keine Fortbildung.
Der Lehrplan in Österreich ist voll. Klimawandel wird oft nur als Nebenpunkt in Biologie oder Geografie behandelt - nie als Querschnittsthema, das in Mathematik (Daten analysieren), Deutsch (Argumentieren), Kunst (Plakate gestalten) oder Technik (Energieprojekte bauen) integriert wird. Das ist das Problem.
Einige Schulen haben das längst gelöst: Die ÖKOLOG-Netzwerkschulen verbinden Umweltbildung mit dem Schulalltag. Sie messen nicht nur den CO₂-Ausstoß, sondern reduzieren ihn - durchschnittlich um 15 Prozent in drei Jahren. Sie vermeiden Abfall - und produzieren 31 Prozent weniger als andere Schulen. Sie schaffen einen Kulturwandel, der nicht von einem Projekt abhängt, sondern Teil der Schule wird.
Was Jugendliche wirklich wollen: Multimedia, Mitmachen, Meinung
Die Generation Z will nicht zugehört werden - sie will mitreden, mitmachen, mitgestalten. Die AUTreach-Befragung zeigt: Die beliebtesten Formate für Klimakommunikation sind nicht die Schulbücher. Es sind:
- Soziale Medien (38,3 %)
- Interaktive Workshops (22,8 %)
- Digitale Spiele (12,1 %)
Das heißt: Eine YouTube-Video-Serie über „Wie ich meine Schule klimafreundlicher gemacht habe“ funktioniert besser als ein 20-seitiges Arbeitsblatt. Ein Escape-Room, bei dem man durch Rätsel herausfindet, wie man Energie spart, ist effektiver als eine PowerPoint-Präsentation.
Und noch etwas: 67 Prozent der Jugendlichen sagen, dass Klimakommunikation „zu generisch“ ist. Sie wollen nicht „die Welt retten“. Sie wollen wissen: Was kann ich tun? Was passt zu mir? Ich mag Kochen? Dann lerne ich, wie man mit regionalen Lebensmitteln klimafreundlich kocht. Ich mag Technik? Dann baue ich einen Energiespar-Tester für die Schule. Ich mag Kunst? Dann gestalte ich eine Wandmalerei über Klimagerechtigkeit.

Was passiert, wenn es funktioniert? Multiplikator:innen im Alltag
Der größte Effekt von handlungsorientierter Klimakommunikation ist nicht die Schule - es ist das Zuhause.
63 Prozent der Schüler*innen, die an Klimaprojekten teilgenommen haben, diskutieren danach häufiger mit ihren Eltern über Klimathemen. Sie fragen: „Warum fahren wir immer mit dem Auto?“ „Können wir nicht mehr Gemüse essen?“ „Warum haben wir so viele Einwegverpackungen?“
Das ist der echte Durchbruch: Schüler*innen werden zu Multiplikator:innen. Sie verändern nicht nur ihre Schule - sie verändern ihre Familie. Und das ist der einzige Weg, wie sich Verhalten langfristig ändert. Nicht durch Gesetze, nicht durch Werbung - durch persönliche, überzeugende Gespräche im Küchenstuhl.
Die Zukunft: Was kommt als Nächstes?
Österreich hat klare Ziele: Bis 2030 sollen alle Schülerinnen und Schüler in handlungsorientierter Klimakommunikation ausgebildet sein. Aktuell sind 45 Prozent der Schulen an einem Programm beteiligt - das ist ein guter Start, aber noch lange nicht genug.
Ein neues Förderprogramm namens KLAR! soll bis 2025 100 Modellregionen mit spezifischen Schulprojekten ausstatten. 47 davon sind bereits aktiv. Und an der Universität für Bodenkultur Wien gibt es seit 2022 einen Hochschullehrgang „Wissenschaftskommunikation für Nachhaltigkeit“ - der Lehrkräfte zu Expert:innen für klare, verständliche und motivierende Klimakommunikation ausbildet.
Die Daten zeigen: Schulen mit handlungsorientierter Klimakommunikation steigern die Handlungsbereitschaft ihrer Schüler*innen um 28 Prozent - im Vergleich zu nur 9 Prozent in Schulen ohne solche Angebote. Das ist kein Zufall. Das ist ein Beweis.
Was du als Lehrkraft oder Elternteil tun kannst - sofort
Du musst kein Klimaexperte sein. Du musst nicht alles wissen. Du musst nur anfangen.
- Starte mit einem kleinen Projekt: Zähle den Müll in der Klasse eine Woche lang - dann überlege, wie man ihn reduzieren kann.
- Frage deine Schüler: Was interessiert euch am meisten? Was würdet ihr gerne ändern? Nutzt das als Ausgangspunkt.
- Verwendet digitale Tools: „Hallo Klima!“ bietet kostenlose, altersgerechte Materialien an - einfach herunterladen und loslegen.
- Vermeide Angst: Redet nicht über Untergang, sondern über Lösungen. Fragt: „Was können wir gemeinsam tun?“ statt „Was ist alles falsch?“
- Feiere kleine Erfolge: Eine Klasse, die eine Woche lang kein Einwegplastik verwendet? Das ist ein Sieg.
Handlungsorientierte Klimakommunikation ist kein Zusatzangebot. Sie ist die Zukunft des Unterrichts. Und sie funktioniert - in Österreich, in der Praxis, mit echten Schüler:innen, die merken: Ich kann etwas bewirken. Und das ist der stärkste Antrieb, den man haben kann.



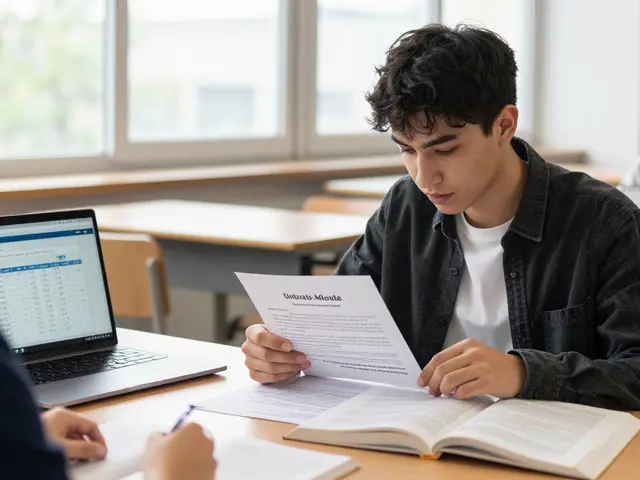

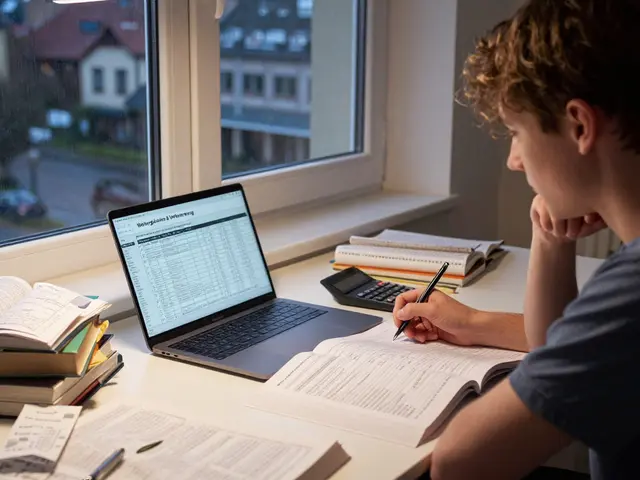

14 Kommentare
Stephan Schär
Das ist ja mal was anderes als die übliche Klima-Angstmacherei! 😄 Endlich mal jemand, der den Jugendlichen nicht sagt, was sie tun sollen, sondern sie einfach loslässt. Ich hab’ neulich meinen Neffen gesehen – der hat mit seiner Klasse einen Strommesser gebaut und jetzt schaltet jeder in der Schule das Licht aus, wenn er rausgeht. So funktioniert’s! 🚀
Joel Lauterbach
Interessant, dass die meisten Schüler wissen, was CO₂ ist, aber nicht, wie sie es reduzieren können. Die Kluft zwischen Wissen und Handeln ist ein klassisches Problem der Bildung. Lösungsorientierung statt Informationsüberflutung – das ist der Schlüssel.
Dieter Krell
Hey, ich hab’ das Klimadedektiv-Programm letztes Jahr in Berlin getestet – total genial! Die Kids haben nicht nur den Stromverbrauch gemessen, sondern auch einen Rap darüber gemacht. YouTube-Videos mit 50k Views und die Schule hat 20% weniger Energie verbraucht. 🤯 Wer sagt, dass Lernen langweilig sein muss?
Astrid Shapiro
Die Zahlen sind schön, aber wer überprüft die Methodik? 82 % motivierter – nach welchem Instrument? Wer hat die Befragung durchgeführt? Und warum wird nicht erwähnt, dass viele dieser Projekte nach einem Jahr wieder eingestellt werden, weil die Lehrer keine Zeit haben? Die Realität ist viel düsterer als diese PR-Story.
Runa Kalypso
das isst ja echt nice!! ich hab in meiner schule auch so ein projekt gemacht, nur mit wiederverwendbaren bechern… aber wir hattn kein budget, also habn wir einfach leute gebeten, ihre eigenen mitzubringen 😅 es hat funktioniert!!
Catharina Doria
Die Studienlage ist eindeutig: Handlungsorientierte Ansätze wirken nur, wenn sie in einem kognitiv-konstruktivistischen Lernrahmen verankert sind – also nicht als oberflächliche Aktionismus-Veranstaltungen, sondern als partizipative, systemische Bildungsprozesse. Die meisten Schulen scheitern an der mangelnden Integration in den Curriculumsentwicklungszyklus. Und ja, die 15 % CO₂-Reduktion sind real – aber nur, wenn die Schule eine nachhaltige Organisationskultur hat. Sonst bleibt es ein Projekt, das nach zwei Jahren abgebrochen wird. Wer das nicht sieht, versteht nicht, wie Bildung funktioniert.
Niklas Lindgren
Ach ja, wieder die übliche Klima-Propaganda. Wer sagt, dass Schüler das alles brauchen? Wir haben doch schon genug politische Indoktrination in den Schulen. Warum nicht einfach mal wieder Mathe, Deutsch und Physik lehren? Die Welt wird nicht von Schulprojekten gerettet, sondern von Technologie und Wirtschaft. Und diese ganzen Plakate mit 'Ausmachen spart!' – das ist bloß Show. Wer glaubt, dass das was bringt?
Nick Ohlheiser
Ich hab’ das mit den Klimadedektiven in meiner Tochter’s Schule live mitbekommen… und ich muss sagen: Es war das Erste, was sie seit Jahren mit echter Begeisterung gemacht hat. Sie kam nach Hause und hat uns gefragt, warum wir immer Plastikverpackungen kaufen… und jetzt haben wir einen Komposter. 🌱 Das ist kein Bildungsprojekt – das ist eine kleine Revolution. Und sie hat ihren Opa dazu gebracht, den Wagen nicht mehr zu benutzen, wenn er zur Oma fährt. Das… das ist Magie.
Lieve Leysen
Yesss!! 🌍💚 Ich hab’ auch so ein Projekt in meiner Klasse gestartet – wir haben eine ‚Grüne Ecke‘ gebaut mit Pflanzen und einem Recycling-Postkasten! Die Kids lieben es! Und die Lehrerin hat sogar ein kleines ‚Klima-Badge‘ für die, die mitmachen 🎖️✨ Das ist so viel besser als irgendwelche Tests!
Brecht Dekeyser
cool das klingt nach einem echten vibe shift in der schule 😎 ich hab in brussels auch so was gesehen – die kids haben ein app entwickelt um leute zu erinnern wenn sie ihr handy nicht aufladen 😂 das war so dumm aber irgendwie genial
Julia Wooster
Die Daten sind schön, aber wer hat sie wirklich analysiert? Wer hat die Kontrollgruppen? Wer hat die sozialen Einflüsse herausgerechnet? Und warum wird nicht erwähnt, dass diese Projekte oft nur in privilegierten Schulen stattfinden? Die Realität der ländlichen Schulen in Niederösterreich ist eine andere – dort gibt es nicht mal einen Internetzugang. Diese Narrative sind gefährlich. Sie verbergen strukturelle Ungleichheit hinter einem falschen Erfolgsglauben.
Herbert Finkernagel
Klima-Aktivismus in der Schule? Das ist die nächste Phase der totalen Kontrolle. Die Eltern werden ausgebremst, die Kinder werden manipuliert, die Lehrer werden zu politischen Agenten. Die Wissenschaft ist nicht abgeschlossen, aber man verbietet Diskussionen. Und dann kommt noch diese ‚Handlungsorientierung‘ – das ist keine Bildung, das ist Gehirnwäsche mit Umwelt-Emoji.
Timon Ostertun
Handlungsorientierung ist doch nur ein Modewort für Lehrer die keine Ahnung haben wie man unterrichtet
Markus Paul
Die Welt retten? Nein. Die Schule verändern? Vielleicht. Aber wer sagt, dass das überhaupt wünschenswert ist? Manchmal ist es besser, einfach zu beobachten. Die Schüler werden nicht durch Projekte zu Denkern – sie werden durch Schweigen zu Menschen.