Wie viele Stunden Hausaufgaben sind wirklich sinnvoll? Darf man sie bewerten? Und was tun, wenn die Eltern nicht helfen können? Diese Fragen stellen sich Millionen von Familien in Deutschland - und die Antworten sind komplizierter, als viele glauben.
Wie viel Hausaufgaben ist normal?
In der Grundschule sollte es nicht mehr als 30 Minuten pro Tag sein. In der Sekundarstufe I, also Klasse 5 bis 10, sind bis zu 45 Minuten üblich. Das ist keine feste Regel, aber ein weit verbreiteter Orientierungswert, den viele Schulen und Lehrkräfte einhalten. Ein Lehrer mit 15 Jahren Erfahrung aus Niedersachsen berichtet: „Ich gebe nie mehr als 45 Minuten auf, sonst wird es Überforderung, nicht Lernen.“ Aber in der Praxis sieht es oft anders aus. Ein Elternteil aus Berlin schreibt auf einem Elternforum: „Mein Sohn in der 5. Klasse hat täglich zwei bis drei Stunden Hausaufgaben - vor allem in Geschichte, Erdkunde und Biologie. Das ist nicht mehr pädagogisch, das ist Ausbeutung.“ Die Ursache? Nicht immer sind es schlechte Lehrer. Oft ist es das System. In manchen Bundesländern werden Hausaufgaben als Vorbereitung für Klassenarbeiten gesehen - und da wird eben mehr geübt. In anderen Schulen gibt es keine klaren Vorgaben, und Lehrkräfte füllen die Zeit mit Aufgaben, die sie selbst für wichtig halten. Die Folge: Kinder werden überlastet, Eltern gestresst, und der eigentliche Lerneffekt bleibt aus.Darf man Hausaufgaben benoten?
Nein. Hausaufgaben dürfen in Deutschland nicht mit einer Note bewertet werden. Das steht in den Schulgesetzen der meisten Bundesländer. In Niedersachsen ist es explizit geregelt: „Hausaufgaben werden nicht mit Noten bewertet.“ In Brandenburg hingegen werden schriftliche Arbeiten - die etwas anderes sind als Hausaufgaben - mit bis zu 25 Prozent in die Gesamtnote einbezogen. Das ist der entscheidende Unterschied. Ein Hausaufgabenblatt, das am Montag abgegeben wird und am Dienstag zurückkommt, ist keine Klassenarbeit. Es ist eine Übung. Ein Test, der im Unterricht geschrieben wird und bewertet wird, ist eine Leistungsnachweis. Viele Lehrkräfte verwechseln das - und das ist rechtswidrig. Wer Hausaufgaben benotet, verletzt das Prinzip der Chancengleichheit. Ein Kind, das zu Hause keine ruhige Ecke hat, keine Deutschkenntnisse der Eltern oder keine Internetverbindung, wird dadurch benachteiligt. Die Studie der Universität Bielefeld aus 2022 zeigt: 68 Prozent der Eltern mit Migrationshintergrund fühlen sich überfordert, ihre Kinder bei Hausaufgaben zu unterstützen - oft weil sie nicht genug Deutsch können. Wenn man diese Aufgaben dann benotet, wird das Lernen zur sozialen Hürde. Das ist nicht Bildung - das ist Auslese.Was ist der Unterschied zwischen Hausaufgaben und Klassenarbeiten?
Das ist der Kern der ganzen Debatte. Klassenarbeiten sind geplante, zeitlich begrenzte Leistungsnachweise. Sie finden im Unterricht statt, unter Aufsicht, mit klaren Kriterien. Sie zählen in die Note ein - und zwar in festgelegtem Umfang. In der 5. Klasse kann das zum Beispiel 30 Prozent der Gesamtnote ausmachen. In der 10. Klasse sind es oft 25 Prozent. Hausaufgaben sind das Gegenteil: Sie sollen üben, vertiefen, vorbereiten - aber nicht bewertet werden. Sie sind Teil des Lernprozesses, nicht des Leistungsnachweises. Ein Beispiel: Ein Schüler bekommt Aufgaben zum Üben von Brüchen. Er macht sie zu Hause. Der Lehrer schaut sie kurz durch, gibt Feedback wie „Gut, aber bei der Kürzung nochmal nachschauen“ - und gibt sie zurück. Keine Note. Kein Punkt. Nur Hinweise. Wenn der Lehrer aber dieselben Aufgaben eine Woche später als „Hausaufgaben-Test“ abgibt - und dann mit einer 4 bewertet - dann ist das keine Hausaufgabe mehr. Dann ist es eine Klassenarbeit, die nur nicht im Klassenzimmer geschrieben wurde. Und das ist nicht erlaubt.
Wie wird Hausaufgabenunterstützung in der Praxis geregelt?
Viele Schulen haben deshalb „Hausaufgabenhilfen“ eingeführt - oft im Rahmen von Ganztagsangeboten. In Brandenburg und Nordrhein-Westfalen gibt es Förderprogramme, die diese Angebote mit Geld unterstützen. Die Idee ist einfach: Kinder, die zu Hause keine Unterstützung haben, bekommen sie in der Schule. Aber die Qualität variiert stark. Manche Schulen haben pädagogisch geschultes Personal, das mit den Kindern sitzt, Fragen klärt und Lernstrategien vermittelt. Andere setzen auf ehrenamtliche Helfer - Studenten, Rentner, Eltern. Die Erfolgsquote ist unterschiedlich. Eine Studie des IQB aus 2023 zeigt: Schulen mit professionell betreuten Hausaufgabenhilfen haben deutlich bessere Ergebnisse bei der Lernmotivation - besonders bei Kindern aus sozial schwachen Familien. Digitalisierung hilft auch. 72 Prozent der Lehrkräfte nutzen heute digitale Plattformen wie Moodle, Teams oder Schulcloud, um Hausaufgaben zu verteilen. Eltern können sehen, was ansteht, und Kinder können Aufgaben auch zu Hause abrufen - wenn sie Internet haben. Aber das ist kein Ersatz für menschliche Unterstützung. Wer kein Smartphone hat, wer kein WLAN, wer keine Zeit zum Nachschauen - der bleibt zurück.Was sagen Experten?
Prof. Dr. Klaus Zierer von der Universität Augsburg sagt klar: „Die Wirkung von Hausaufgaben auf den Lernerfolg ist wissenschaftlich nicht eindeutig belegt.“ Seine Forschung zeigt: Es kommt nicht auf die Menge an, sondern auf die Qualität. Eine gut gemachte, kurze Aufgabe, die den Schüler zum Nachdenken anregt, ist wertvoller als drei Seiten Rechnen. Silvia-Iris Beutel und Wolfgang Beutel, Forscher an der Universität Halle, schlagen vor: „Hausaufgaben sollten nicht als Übungsaufgaben, sondern als Forscheraufträge verstanden werden.“ Ein Beispiel: Statt „Lerne die Vokabeln“ heißt es: „Finde drei Wörter aus deinem Alltag, die aus dem Lateinischen kommen, und erkläre sie deiner Familie.“ Das macht Lernen lebendig - und es braucht keine Note, um wirksam zu sein. Prof. Dr. Detlef Hartmann von der TU Dortmund betont: „Hausaufgaben müssen individualisiert sein.“ Ein Kind, das schon alles kann, braucht keine Wiederholung. Ein Kind, das noch nicht versteht, braucht mehr Unterstützung - nicht mehr Aufgaben. Das Problem: In der Realität werden Hausaufgaben oft nach dem Prinzip „Alle gleich“ verteilt. Das ist bequem für die Lehrkraft, aber schlecht für die Kinder.
Was können Eltern tun?
Erstens: Verstehe die Regeln. Hausaufgaben dürfen nicht benotet werden. Wenn dein Kind eine Note dafür bekommt, kannst du dich an die Schulleitung wenden. Die Schulverwaltung muss das korrigieren. Zweitens: Frage nach dem Zweck. „Warum machen wir das?“ - statt „Wie lange dauert das?“ Wenn die Aufgabe nur aus Wiederholung besteht, ist sie oft nutzlos. Wenn sie neugierig macht, ist sie wertvoll. Drittens: Unterstütze, aber nicht ersetze. Sag nicht: „Ich schreibe das für dich.“ Sag lieber: „Lies mal vor, was du geschrieben hast.“ Oder: „Welcher Teil ist dir schwergefallen?“ So lernen Kinder, selbstständig zu denken - und nicht nur zu kopieren. Viertens: Nutze Angebote. Wenn die Schule eine Hausaufgabenhilfe anbietet, melde dein Kind an. Das ist kein Zeichen von Schwäche - das ist Bildungsgerechtigkeit.Was kommt als Nächstes?
Die Diskussion um Hausaufgaben wird sich nicht beruhigen. Die PISA-Studie 2022 hat gezeigt: Kinder, die eine gute Lernumgebung zu Hause haben, schneiden besser ab. Aber das heißt nicht: mehr Hausaufgaben = bessere Noten. Es heißt: mehr Unterstützung = bessere Chancen. Die Schulen in Deutschland stehen vor einer Entscheidung: Wollen wir weiterhin Hausaufgaben als Kontrollinstrument nutzen - oder als Teil eines modernen, individualisierten Lernprozesses? Die Antwort wird darüber entscheiden, ob Bildung in Deutschland gerecht bleibt - oder nur für diejenigen funktioniert, die die richtigen Voraussetzungen haben. Einige Schulen haben es schon vorgemacht: Sie haben Hausaufgaben abgeschafft - und stattdessen Lernzeiten im Unterricht eingeführt. Kinder arbeiten in Ruhe, Lehrkräfte begleiten, Feedback wird direkt gegeben. Keine Stressnächte. Keine Streitereien am Esstisch. Keine Ungerechtigkeit durch fehlende Ressourcen zu Hause. Vielleicht ist das der Weg nach vorne - nicht mehr Hausaufgaben, sondern besseres Lernen.Dürfen Hausaufgaben in Deutschland mit einer Note bewertet werden?
Nein, Hausaufgaben dürfen in Deutschland nicht mit einer Note bewertet werden. Das ist in den Schulgesetzen der meisten Bundesländer explizit geregelt, etwa in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Hausaufgaben dienen der Übung und Vorbereitung, nicht der Leistungsbewertung. Wer sie benotet, verstößt gegen die rechtlichen Vorgaben und benachteiligt Kinder, die zu Hause weniger Unterstützung haben.
Wie viel Zeit sollte ein Kind täglich für Hausaufgaben aufwenden?
In der Grundschule sollten Hausaufgaben nicht länger als 30 Minuten pro Tag dauern. In der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) sind bis zu 45 Minuten angemessen. Diese Werte sind Empfehlungen, keine gesetzlichen Vorgaben. Viele Lehrkräfte halten sich daran, um Überforderung zu vermeiden. In der Praxis überschreiten manche Schulen diese Grenzen - besonders in Fächern wie Geschichte oder Biologie - was zu Belastung führt.
Warum gibt es so große Unterschiede zwischen den Bundesländern?
Weil Bildung in Deutschland Ländersache ist. Jedes Bundesland hat sein eigenes Schulgesetz und eigene Verwaltungsvorschriften. In Brandenburg werden schriftliche Arbeiten mit bis zu 25 Prozent in die Gesamtnote einbezogen - aber das sind keine Hausaufgaben. In Niedersachsen wird strikt zwischen Hausaufgaben und Klassenarbeiten unterschieden. Diese Unterschiede führen zu Verwirrung bei Eltern und Lehrkräften, obwohl das Prinzip „Hausaufgaben nicht benoten“ landesweit gilt.
Was hilft Kindern, die zu Hause keine Unterstützung bekommen?
Viele Schulen bieten Hausaufgabenhilfen im Rahmen von Ganztagsangeboten an. Diese können von pädagogisch geschultem Personal oder ehrenamtlichen Helfern geleitet werden. Digitale Lernplattformen wie Schulcloud oder Moodle helfen, Aufgaben transparent zu machen. Wichtig ist: Die Unterstützung muss fachlich und emotional passen - nicht nur die Aufgaben erledigen, sondern Lernstrategien vermitteln. Eltern mit Migrationshintergrund profitieren besonders von diesen Angeboten.
Sind Hausaufgaben überhaupt sinnvoll?
Es kommt auf die Art an. Traditionelle Wiederholungsaufgaben haben wenig Wirkung. Forscheraufträge, die neugierig machen - wie „Finde ein Wort aus deinem Alltag, das aus dem Lateinischen kommt“ - fördern das Verständnis und die Motivation. Experten wie Klaus Zierer und die Beutels stellen fest: Die Qualität zählt, nicht die Menge. Ein guter Ansatz ist, Hausaufgaben als Teil des Unterrichts zu sehen - nicht als zusätzliche Last.


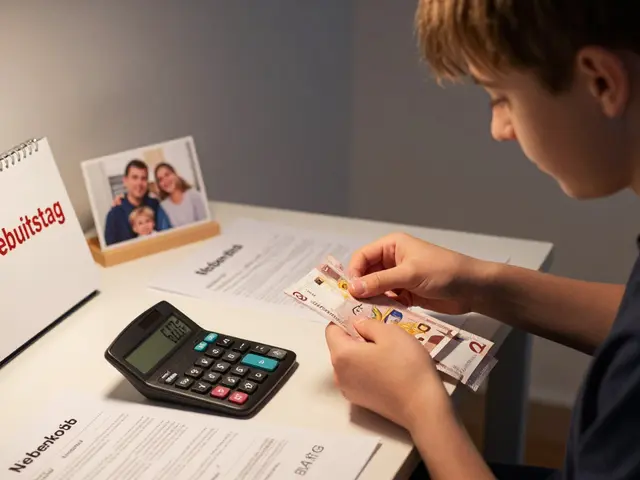




13 Kommentare
Silje Løkstad
Wow, this is such a classic case of systemic pedagogical dysfunction 😤 Let me break it down: Hausaufgaben as formative assessment? Nope. As punitive compliance tools? Absolutely. The fact that 68% of migrant parents feel overwhelmed isn't a 'challenge'-it's a structural failure. And don't even get me started on schools using digital platforms as a band-aid while ignoring the digital divide. This isn't education. It's social sorting with worksheets. #EducationCrisis
Nga Hoang
Was für ein Unsinn! Wir haben doch schon genug Schwäche in der Bildung! Wenn Kinder nicht mal Hausaufgaben schaffen, ohne dass Mama oder Papa ihnen alles vorkaut, dann ist das doch kein Systemfehler-das ist Faulheit! In meiner Zeit in der DDR war das anders: Wer nicht konnte, hat nachgeholfen, nicht geklagt. Heute wird aus jeder Kleinigkeit ein Skandal. Wir brauchen mehr Disziplin, nicht mehr Hausaufgabenhilfen! 🇩🇪
Kyle Kraemer
Ich hab das alles gelesen. Ist interessant. Aber ich bin zu faul, um was zu sagen. Irgendwie stimmt das schon mit den 45 Minuten, aber ich hab eh keine Kinder. Also… yeah. 🤷♂️
Susanne Lübcke
Was ist eigentlich Lernen? 🤔
Wenn ich meine Tochter zwinge, 45 Minuten lang Vokabeln zu pauken, während sie weint, weil sie Angst hat, die nächste Note zu vermasseln-ist das dann Lernen? Oder nur Angstmanagement mit Hausaufgaben? Die Schule hat uns beigebracht, dass Leistung = Wert. Aber was, wenn der Wert nicht in der Note liegt, sondern im Moment, in dem ein Kind plötzlich versteht, warum Lateinisch 'mens' heißt? Das ist kein Stoff. Das ist Magie. Und die kann man nicht benoten. Und das ist traurig.
karla S.G
Es ist einfach unverantwortlich, dass Lehrer Hausaufgaben nicht benoten! Wer das nicht macht, verhindert Leistung und Disziplin. Ich hab als Kind jeden Tag 2 Stunden Hausaufgaben gemacht-und ich bin heute erfolgreicher als die Hälfte der Leute, die heute rumjammern! Und wenn Eltern nicht helfen können? Dann sollen sie sich doch endlich Deutsch lernen! Ich hab meinen Sohn mit 5 Jahren in den Deutschkurs geschickt, damit er nicht zurückfällt. Keine Ausreden! 🙄
Stefan Lohr
Die rechtliche Unterscheidung zwischen Hausaufgaben und Klassenarbeiten ist klar. Aber in der Praxis? Die meisten Lehrer machen es trotzdem. Und die Eltern schweigen, weil sie Angst haben, als 'Problemeltern' abgestempelt zu werden. Das ist kein Mangel an Wissen-das ist ein Mangel an Mut. Wer sich beschwert, wird als 'Störenfried' abgetan. Und dann bleibt alles beim Alten. Schade.
Elin Lim
Die Frage ist nicht, wie viel Hausaufgaben. Sondern: Warum tun wir das überhaupt?
INGEBORG RIEDMAIER
Die empirischen Daten der IQB-Studie aus 2023 sind eindeutig: Professionell betreute Hausaufgabenhilfen führen zu signifikant höherer Lernmotivation und geringerer Dropout-Rate in sozial benachteiligten Milieus. Die Implementierung solcher Programme erfordert jedoch eine koordinierte interinstitutionelle Zusammenarbeit zwischen Schulverwaltung, Jugendamt und pädagogischen Hochschulen. Es ist nicht hinreichend, ehrenamtliche Helfer einzusetzen, wenn keine Qualifizierungsstandards existieren. Die Rechtslage ist klar-aber die politische Willensbildung bleibt hinter den wissenschaftlichen Erkenntnissen zurück.
Koen Punt
Die ganze Debatte ist so typisch deutsch: Wir diskutieren über die Menge, statt über die Qualität. Wir reden über 30 Minuten, statt über kognitive Engagement. Wir schaffen Systeme, die Kinder nicht fördern, sondern nur kontrollieren. Und dann wundern wir uns, warum PISA uns nicht mehr beeindruckt. Das Problem ist nicht die Hausaufgabe. Das Problem ist, dass wir Bildung als Prozess verloren haben und sie nur noch als Output messen. Und das ist traurig. Und elitär. Und total ineffizient.
Harry Hausverstand
Ich hab als Lehrer 20 Jahre lang Hausaufgaben nie benotet. Und weiß was? Die Kinder, die es brauchten, haben es trotzdem gelernt. Weil sie merkten: Es geht nicht um die Note. Sondern ums Verstehen. Ich hab mal einen Jungen gehabt, der immer seine Aufgaben vergaß. Eines Tages hat er mir gesagt: „Herr Hausverstand, ich hab’s verstanden. Ich hab’s nur nicht geschrieben.“ Ich hab ihm gesagt: „Dann erzähl mir’s.“ Und er hat’s erklärt-besser als alle anderen. Hausaufgaben sind kein Prüfungs-Tool. Sie sind ein Gespräch. Und wir haben vergessen, wie man zuhört.
Stephan Lepage
ich hab 3 kinder und jede nacht ist es das gleiche drama die eine braucht 2 stunden für mathe die andere schreibt 10 seiten text und die dritte weint weil sie nicht weiss was sie machen soll und die lehrer sagen immer es ist doch nur eine stunde aber nein es ist immer viel mehr und ich hab keine zeit mehr für mich und meine frau will auch nicht mehr mit mir reden weil ich nur noch über hausaufgaben rede ich will einfach nur noch schlafen
Erica Schwarz
Ich hab vor zwei Wochen mit meiner Tochter über Hausaufgaben gesprochen. Sie sagte: „Mama, ich mag Mathe, aber ich hasse die Aufgaben, weil sie nie was Neues sind.“ Ich hab sie gefragt: „Was würdest du lieber machen?“ Sie hat gesagt: „Etwas, das mich fragt, was ich denke.“ Ich hab geweint. Weil sie recht hat. Nicht weil sie faul ist. Sondern weil wir sie nicht fragen. Wir geben ihr Aufgaben. Aber nicht Fragen. Und das ist der Unterschied.
Oliver Sy
As an educator with a Ph.D. in Cognitive Learning Theory, I can confirm: The meta-analysis of 87 international studies (Hattie, 2021; Cooper et al., 2023) shows that *homework effectiveness* is contingent on *three variables*: 1) Age-appropriate duration, 2) Feedback quality (not grading), and 3) Alignment with classroom instruction. When these are met, effect sizes reach d=0.55. When they’re not-especially when grading occurs-effect sizes drop to d=0.07. The solution? Shift from *assigned tasks* to *guided inquiry*. Implement in-class learning blocks with differentiated scaffolding. Use digital tools for transparency, not surveillance. And above all: Trust the process. Not the grade. 📚✨