Warum Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund entscheidend ist
Deutsch zu sprechen ist nicht nur eine Fähigkeit - es ist der Schlüssel zur Schule, zu Freunden, zu Chancen. Kinder, die zu Hause kaum Deutsch hören, starten in der Kita oder Grundschule mit einem deutlichen Nachteil. Der Bildungsmonitor 2024 zeigt klar: Wer in einer Familie aufwächst, in der kaum Deutsch gesprochen wird, hat deutlich geringere Chancen, das Gymnasium zu besuchen - selbst wenn seine kognitiven Fähigkeiten genauso gut sind wie die von Kindern mit deutscher Muttersprache. Die Ursache? Nicht mangelnde Intelligenz, sondern mangelnde Sprachkompetenz. Sprachförderung ist daher kein Zusatzangebot, sondern eine Grundvoraussetzung für Bildungsgerechtigkeit.
Was läuft schon in Kitas und Schulen?
Deutschland hat in den letzten Jahren ein Netzwerk von Programmen aufgebaut, um diese Lücke zu schließen. Das bekannteste ist das Bundesprogramm Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist. Bis Ende 2022 hat es in jeder zehnten Kita in Deutschland zusätzliche Fachkräfte finanziert - Menschen, die gezielt mit Kindern spielen, singen und erzählen, um ihren Wortschatz zu erweitern. Heute nehmen über 60 Prozent aller Kitas an solchen Fördermaßnahmen teil. Das ist ein Fortschritt. Aber es reicht nicht. In vielen Regionen gibt es immer noch zu wenig Personal, zu lange Wartelisten, zu wenig Zeit für individuelle Förderung.
In der Grundschule kommen viele Kinder mit kaum Deutschkenntnissen an. Dort werden sie oft in sogenannten Auffangklassen untergebracht - kleine Gruppen, die nur Deutsch lernen, ohne den regulären Unterricht zu besuchen. Doch diese Klassen sind kein Langzeitlösung. Sie isolieren die Kinder, statt sie einzubinden. Ein besseres Modell kommt aus Duisburg: Die Regenbogenschule in Marxloh hat einen anderen Ansatz. Hier bleiben Kinder, die noch nicht genug Deutsch können, fünf statt vier Jahre in der Grundschule. Sie bekommen mehr Zeit - für Sprache, für Mathe, für Sozialkompetenz. Keine Eile, kein Druck. Das Ergebnis? Mehr Kinder schaffen den Übergang auf die weiterführende Schule.
Das Startchancen-Programm: Geld für Schulen in schwierigen Lagen
Seit 2024 gibt es ein neues, großes Bundes-Länder-Programm: Startchancen. Mit rund 20 Milliarden Euro bis 2027 sollen Schulen in sozial schwachen Vierteln unterstützt werden. In Duisburg, Berlin-Neukölln oder Hamburg-Steinwerder - Orte, wo viele Kinder mit Migrationshintergrund zur Schule gehen - werden jetzt nicht nur Lehrerinnen und Lehrer mehr bezahlt, sondern auch Sozialarbeiter, Sprachtherapeuten, Mentoren. Die Idee ist einfach: Bildungserfolg darf nicht davon abhängen, wo du wohnst oder welche Sprache deine Eltern sprechen. Die Schule muss die Lücke schließen. Bis 2027 sollen 4.000 Schulen dieses Programm nutzen. Aktuell sind es aber nur etwa 10 Prozent aller Schulen. Die Experten des Bildungsmonitors fordern: Erweitern auf 40 Prozent. Nur dann wird die Wirkung spürbar.

Deutsch als Zweitsprache - und die Herkunftssprache nicht vergessen
Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Kinder ihre Muttersprache verlieren, wenn sie Deutsch lernen. Ganz im Gegenteil: Wer seine Herkunftssprache behält, lernt Deutsch schneller und tiefer. Die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat das verstanden. Dort gibt es nicht nur Deutschunterricht, sondern auch Kurse in Arabisch, Ukrainisch oder Farsi - als Ergänzung, nicht als Ersatz. Diese Kurse stärken das Selbstbewusstsein der Kinder. Sie sagen: Deine Sprache ist wertvoll. Deine Herkunft ist Teil deiner Stärke. Forscher wie Marcel Helbig vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe bestätigen: Kinder mit starken Herkunftssprachen zeigen oft bessere Leistungen in Deutsch, weil sie lernen, wie Sprache funktioniert - und das ist eine Fähigkeit, die man nicht lernen kann, wenn man nur eine Sprache kennt.
Eltern einbinden - das Geheimnis der langfristigen Wirkung
Die größte Herausforderung? Die Eltern. Viele Mütter und Väter arbeiten zwei Schichten, haben Angst, sich zu verfahren, fühlen sich in der Schule überfordert. Deshalb funktioniert Sprachförderung nur, wenn die Familie mitgenommen wird. In Nordrhein-Westfalen bieten viele Schulen Elterncafés an: Einmal pro Woche treffen sich Eltern, trinken Kaffee, lernen gemeinsam Deutsch - und bekommen Tipps, wie sie zu Hause mit ihren Kindern sprechen können. Nicht als Nachhilfelehrer, sondern als Gesprächspartner. "Was können wir als Eltern tun?", fragt Dorothee Feller, Bildungsministerin von NRW. Die Antwort: Fragen stellen. Geschichten erzählen. Vorlesen. Auch wenn es nur auf Arabisch oder Ukrainisch ist. Sprache entsteht im Alltag - nicht nur im Klassenzimmer.

Warum Tests schon im Alter von vier Jahren nötig sind
Die beste Sprachförderung ist die, die früh anfängt. Studien zeigen: Kinder, die mit vier Jahren Sprachdefizite haben, brauchen bis zur vierten Klasse doppelt so viel Zeit, um aufzuholen - und oft schaffen sie es trotzdem nicht. Deshalb fordern Wissenschaftler bundesweit verpflichtende Sprachtests in Kitas ab vier Jahren. Keine Strafe. Keine Angst. Ein einfacher Check: Kann das Kind Anweisungen verstehen? Kann es Wörter benennen? Kann es einen Satz bauen? Wenn nicht - dann wird sofort gefördert. In Bayern und Hessen gibt es solche Tests schon. Aber nicht überall. Und die Kita-Pflicht für Kinder mit Sprachdefiziten bis zur Einschulung ist umstritten. Viele Eltern sehen das als Eingriff in ihre Freiheit. Dabei geht es nicht um Zwang - sondern um Chancengleichheit. Jedes Kind hat das Recht, in der Schule mitzukommen. Und dafür braucht es frühzeitige Hilfe.
Was funktioniert - und was nicht?
Einige Ansätze haben sich bewährt: Kleine Gruppen, feste Rituale, viel Spiel, viel Lob, Zeit. Andere scheitern: Einmalige Workshops, Sprachkurse ohne Bezug zum Alltag, Lehrer, die keine Ausbildung in Deutsch als Zweitsprache haben. Die Hilfe-Alliance in Flörsheim macht es richtig: Kinder lernen Deutsch beim Fußball, beim Kochen, beim Basteln. Kein Buch, kein Arbeitsblatt. Nur echte Begegnung. Und das ist es, was zählt. Sprache ist kein Fach. Sie ist eine Brücke - zwischen Menschen, zwischen Kulturen, zwischen Zukunft und Gegenwart.
Die Zukunft: Von der Förderung zur Gleichstellung
Die Zahlen sind klar: Mehr als ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben eine Einwanderungsgeschichte. Das ist keine Minderheit - das ist die Mehrheit der Zukunft. Sprachförderung darf nicht länger ein Randthema sein. Sie muss in den Kern des Bildungssystems integriert werden. Mit mehr Personal, mehr Geld, mehr Mut. Die Programme existieren. Die Erfolge sind messbar. Jetzt geht es darum, sie nicht nur zu finanzieren, sondern zu skalieren. Jedes Kind, egal woher es kommt, muss die Chance haben, Deutsch zu lernen - nicht als Pflicht, sondern als Tür zu einer besseren Zukunft.
Warum ist Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund so wichtig?
Sprachkompetenz ist die Grundlage für alles Lernen. Kinder, die Deutsch nicht verstehen, können den Unterricht nicht folgen - egal wie intelligent sie sind. Ohne Sprache gibt es keine Teilhabe an Schule, Freundschaften oder später am Arbeitsmarkt. Studien zeigen: Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen bleiben häufiger in der Grundschule, wechseln seltener aufs Gymnasium und haben später geringere Chancen auf Ausbildung und Job. Sprachförderung ist also keine Hilfe, sondern eine Voraussetzung für Bildungsgerechtigkeit.
Welche Programme gibt es für Kinder in der Kita?
Das wichtigste Bundesprogramm heißt "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist". Es hat seit 2016 zusätzliche Sprachförderkräfte in jeder zehnten Kita finanziert - also über 10.000 Stellen bundesweit. In diesen Kitas arbeiten speziell geschulte Fachkräfte, die mit Kindern durch Spiel, Lieder und Alltagssituationen die deutsche Sprache aufbauen. Zusätzlich unterstützen viele Länder eigene Programme, etwa mit Sprachspielgruppen, Elternberatung oder multilingualen Materialien. Über 60 Prozent aller Kitas nehmen heute an mindestens einem Sprachförderprogramm teil.
Was ist das Startchancen-Programm?
Das Startchancen-Programm ist ein gemeinsames Projekt von Bund und Ländern, das seit 2024 Schulen in sozial schwachen Gebieten mit bis zu 20 Milliarden Euro bis 2027 fördert. Ziel ist es, Schulen in Vierteln mit hohem Migrationsanteil besser auszustatten: mit mehr Personal (Sozialarbeiter, Sprachtherapeuten), besseren Lernräumen und langfristiger Unterstützung. Bis 2027 sollen 4.000 Schulen davon profitieren - bisher sind es nur etwa 10 Prozent. Experten fordern, diesen Anteil auf 40 Prozent zu erhöhen, damit die Wirkung wirklich flächendeckend ist.
Sollten Kinder mit Sprachdefiziten eine Kita-Pflicht haben?
Das ist umstritten. Einerseits zeigt die Forschung: Je früher Sprachförderung beginnt, desto erfolgreicher ist sie. Kinder mit Defiziten ab vier Jahren sollten daher gezielt gefördert werden - idealerweise durch verpflichtende Sprachtests in Kitas. Andererseits sehen viele Eltern eine Kita-Pflicht als Eingriff in ihre Erziehungsfreiheit. Die Lösung liegt nicht im Zwang, sondern in der Anreizstruktur: Eltern sollen motiviert werden, die Förderung anzunehmen - durch Beratung, durch einfache Angebote, durch Vertrauen. Es geht nicht darum, Eltern zu bestrafen, sondern sie zu unterstützen.
Warum ist die Herkunftssprache wichtig für das Deutschlernen?
Wer seine Muttersprache behält, lernt eine zweite Sprache schneller und tiefer. Die Fähigkeit, Sprache zu strukturieren, Wörter zu verknüpfen, Grammatik zu verstehen - das ist eine allgemeine Kompetenz. Wer sie in der Herkunftssprache entwickelt, kann sie auf Deutsch übertragen. Außerdem stärkt die Herkunftssprache das Selbstwertgefühl der Kinder. Sie fühlen sich nicht als "defizitär", sondern als bilingual - mit zwei Stärken. Länder wie Rheinland-Pfalz fördern deshalb aktiv Herkunftssprachenunterricht als Ergänzung zum Deutschunterricht - nicht als Ersatz.
Was machen Schulen wie die Regenbogenschule in Duisburg anders?
Die Regenbogenschule in Duisburg Marxloh lässt Kinder, die noch nicht genug Deutsch können, fünf statt vier Jahre in der Grundschule. Sie verzichtet auf Druck und beschleunigte Förderung. Stattdessen gibt es Zeit - für Sprache, für Mathematik, für soziale Entwicklung. Die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in kleinen Gruppen, mit viel Wiederholung und Alltagsbezug. Keine Auffangklasse, kein Aussondern. Die Kinder lernen gemeinsam mit ihren Klassenkameraden - nur langsamer. Das Ergebnis: Mehr Kinder schaffen den Übergang auf die weiterführende Schule, und sie bleiben länger motiviert.


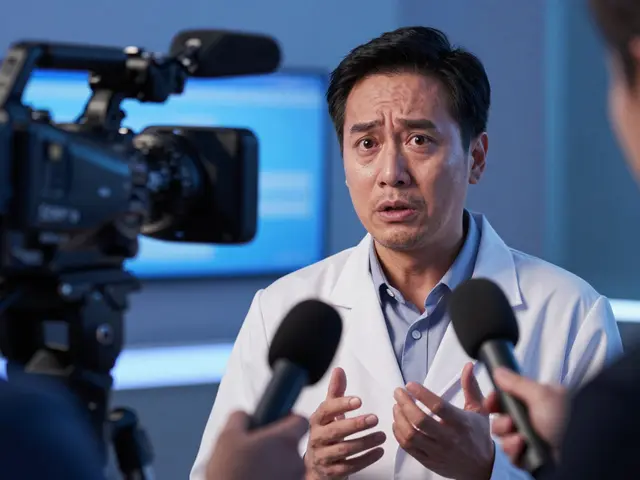

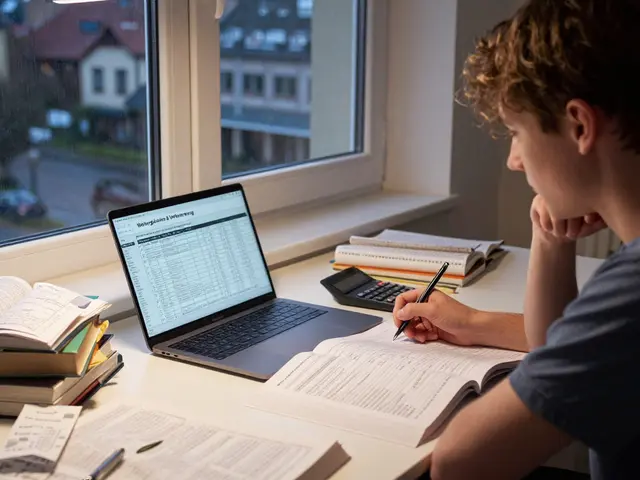
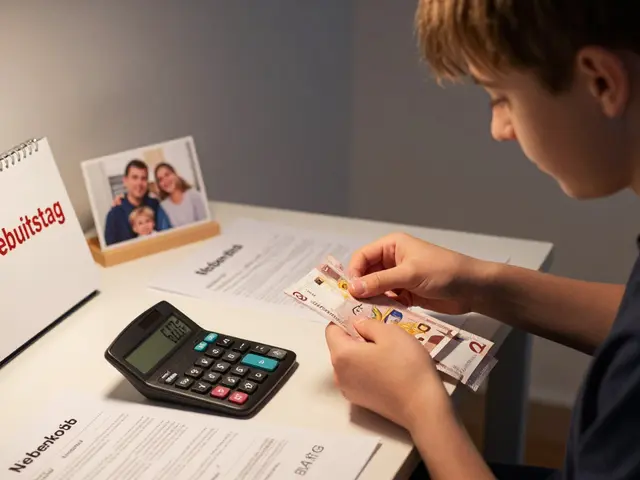

13 Kommentare
Erica Schwarz
Ich hab neulich mit einer Mutter aus Syrien geredet, die jeden Abend mit ihrem Sohn Bücher auf Arabisch vorliest. Sie sagt, er lernt jetzt Deutsch wie eine Rakete - weil er schon versteht, wie Sprachen funktionieren. Das ist das Geheimnis, das viele ignorieren.
Oliver Sy
Die empirischen Daten zur Sprachkompetenzentwicklung bei bilingualen Kindern sind eindeutig: Eine stabilisierte L1 (Herkunftssprache) korreliert signifikant mit höheren L2 (Deutsch)-Erwerbsraten, wie die Longitudinalstudien von Helbig (2023) belegen. Die Integration von Herkunftssprachen in den curricularen Rahmen ist kein Luxus, sondern eine kognitiv-linguistische Notwendigkeit.
Steffen Ebbesen
Ja, super. Und jetzt zahlen wir noch mehr Steuergelder für Kurse in Farsi, während deutsche Kinder in Mathe abgehängt werden. Das ist nicht Gerechtigkeit, das ist politisch korrekter Müll.
Stephan Brass
die regenbogenschule? lol. fünf jahre grundschule? das ist doch nur ne verlängerung des problems. die kinder brauchen keine extra jahre, die brauchen richtige lehrer. nicht mehr zeit, mehr kompetenz.
Sven Schoop
WIR müssen doch nicht alles finanzieren! Warum zahlen wir für Arabisch-Kurse, wenn die Eltern doch zu Hause Deutsch sprechen könnten? Das ist doch total verkehrt! Ich hab doch auch kein Arabisch gelernt, als meine Eltern aus Polen kamen!
Markus Fritsche
Ich denke oft darüber nach: Was ist Sprache eigentlich? Nicht nur Wörter. Es ist Zugehörigkeit. Wenn ein Kind auf Arabisch ein Lied singt, dann fühlt es sich nicht als Fremder. Es fühlt sich wie zu Hause. Und dann kommt Deutsch nicht als Bedrohung, sondern als neue Tür. Vielleicht ist das der echte Schlüssel.
Frank Wöckener
Und wer bezahlt das alles? Die Steuerzahler? Ich hab 3 Kinder, und meine Tochter muss in einer Klasse mit 28 Kindern sitzen, davon 12 mit Migrationshintergrund, und keiner kann sich konzentrieren. Das ist kein Förderprogramm, das ist ein Chaos mit Budget!
Markus Steinsland
Die Strukturanalyse der Bildungsungleichheit zeigt, dass die institutionelle Ressourcenallokation in sozialen Brennpunkten strukturell unzureichend ist. Die Startchancen-Initiative ist ein Anfang, aber ohne standardisierte Diagnoseverfahren und qualifizierte Fachkräfte in allen Schulen bleibt es ein symbolisches Projekt.
Rosemarie Felix
Ich hab ne Freundin, die arbeitet in einer Kita. Die sagt: Die meisten Eltern wollen helfen, aber die wissen nicht wie. Und dann kommen die Lehrer mit 10 Seiten Anleitungen und erwarten, dass die Mütter das lesen. Ach komm. Einfach nur reden. Mit den Kindern. Egal auf welcher Sprache.
Lea Harvey
Deutsch ist unsere Sprache. Warum muss man Kinder mit Migrationshintergrund anders behandeln? Die sollen Deutsch lernen, nicht Arabisch oder Ukrainisch. Sonst wird Deutschland bald nur noch eine multikulturelle Bühne ohne Identität.
Jade Robson
Ich hab neulich in einer Kita in Leipzig einen Jungen gesehen, der jeden Tag mit seiner Oma auf Pashto Geschichten erzählt hat. Und dann hat er mit den anderen Kindern auf Deutsch ein Lied gesungen. Keiner hat gedacht, dass das komisch ist. Es war einfach normal. Vielleicht ist das die Zukunft: Nicht alle gleich, sondern alle willkommen. Mit ihrer Sprache, mit ihrem Herz.
Matthias Kaiblinger
Als Kind meiner Eltern, die aus der Türkei kamen, hab ich nie Deutsch gelernt, weil sie es nicht konnten. Ich hab es in der Schule gelernt. Aber ich hab nie einen Kurs in Türkisch gehabt. Warum jetzt plötzlich alle Sprachen fördern? Weil es trendy ist? Wir brauchen keine multikulturellen Theaterstücke. Wir brauchen Kinder, die Deutsch können. Punkt. Alles andere ist Ablenkung.
Kari Viitanen
Ich komme aus Norwegen. Dort haben wir seit 2010 ein ähnliches Programm. Die Erfahrung: Je früher die Kinder in eine sprachlich reiche Umgebung kommen, desto besser. Aber es braucht Geduld. Nicht alle Kinder lernen gleich schnell. Und das ist okay. Wichtig ist, dass sie sich sicher fühlen. Sprache wächst in Vertrauen.