Stipendien in Deutschland sind keine Glückssache. Wer sie bekommt, hat meistens gut recherchiert, pünktlich beworben und ein persönliches Motivationsschreiben geschrieben, das wirklich etwas sagt. Es gibt über 2.000 Förderprogramme - von kleinen regionalen Stiftungen bis hin zu großen bundesweiten Programmen wie dem Deutschlandstipendium. Aber nur etwa 62 Prozent davon sind in den großen Datenbanken gelistet. Das bedeutet: Wenn du dich nur auf eine Plattform verlässt, verpasst du wahrscheinlich mehr als ein Drittel der Möglichkeiten.
Welche Datenbanken lohnen sich wirklich?
Die e-fellows.net-Datenbank ist mit über 1.100 Angeboten die umfangreichste Sammlung in Deutschland. Sie deckt alle Bildungsphasen ab: von Schülern und Schülerinnen bis zu Doktoranden und Postdocs. Du kannst nach Studienfach, sozialem Hintergrund, Region oder sogar nach speziellem Engagement filtern - etwa ob du dich in der Nachhilfe engagierst oder ein internationales Profil hast. Aber Achtung: Für den vollen Zugriff musst du dich registrieren. Einige exklusive Stipendien, etwa für Master- oder MBA-Studierende, sind nur für Mitglieder sichtbar. 85 Prozent der anderen Plattformen bieten so etwas nicht an.
Die DAAD-Stipendiendatenbank ist kostenlos und besonders nützlich, wenn du aus dem Ausland kommst oder ins Ausland willst. Sie listet 170 Programme, die sich auf internationale Mobilität konzentrieren - zum Beispiel das RISE-Praktikum in Kanada oder Forschungsaufenthalte in Japan. Aber wenn du in Deutschland bleibst und ein deutsches Stipendium suchst, ist sie nicht die beste Wahl. Sie ist auf internationale Bewerber:innen ausgerichtet, nicht auf lokale Förderungen.
Die arbeiterkind.de-Plattform ist ideal, wenn du aus einer Familie kommst, in der niemand studiert hat. Hier findest du speziell auf sozial Benachteiligte zugeschnittene Förderungen. Der Trick: Gib nicht einfach „Stipendium“ ein, sondern kombiniere „Deutschlandstipendium“ mit dem Namen deiner Hochschule. So findest du lokale Angebote, die sonst kaum jemand findet.
Und dann gibt es noch die Spezialisten: Der VdÜ (Verband der Literaturübersetzer) hat eine eigene Datenbank mit 47 Stipendien für Übersetzer:innen. Da steht zum Beispiel das Babelwerk-Stipendium - 2.000 Euro für Archivarbeiten an Nachlässen, mit Frist am 1. Dezember 2025. Solche Angebote findest du nirgendwo sonst. Wenn du in einem Nischenbereich studierst, lohnt sich die Suche in Fachverbänden immer.
Fristen sind kein Vorschub - sie sind dein Schlüssel
Die meisten Stipendien haben nur eine Bewerbungsfrist pro Jahr. Und die liegt oft zwischen Januar und März für das kommende Wintersemester. Wer erst im Sommer anfängt zu suchen, hat schon verloren. Die besten Bewerber:innen planen mindestens sechs Monate im Voraus. Sie erstellen eine eigene Fristentabelle - mit Datum, Stipendium, Kontakt, Link und einem Hinweis, ob es eine Vorprüfung braucht.
Beispiel: Das Deutschlandstipendium läuft meistens vom 1. Juli bis 30. September. Aber jede Hochschule entscheidet selbst, wann sie die Ausschreibung startet. An der HfMDK Frankfurt bewerben sich über 1.200 Studierende für nur 99 Plätze. Das ist eine Quote von 8 Prozent. Wenn du nicht pünktlich bist, hast du keine Chance.
Manche Stipendien haben sogar mehrere Fristen. Das CAPES-Humboldt-Programm für Doktoranden aus Brasilien hat zwei Bewerbungsrunden pro Jahr - aber nur 20 bis 25 Prozent der Bewerber:innen bekommen es. Wer sich erst zwei Wochen vor der Frist meldet, wird abgelehnt, weil das Auswahlkomitee schon Hunderte von Bewerbungen geprüft hat.
Verwende Tools wie Google Kalender oder Notion, um Erinnerungen zu setzen. Setze mindestens vier Wochen Vorlauf. Warum? Weil viele Stipendien Dokumente verlangen, die Zeit brauchen: Empfehlungsschreiben von Professoren, Übersetzungen von Zeugnissen, Nachweise über soziales Engagement. Das dauert. Und wenn dein Professor erst am letzten Tag antwortet, bist du raus.
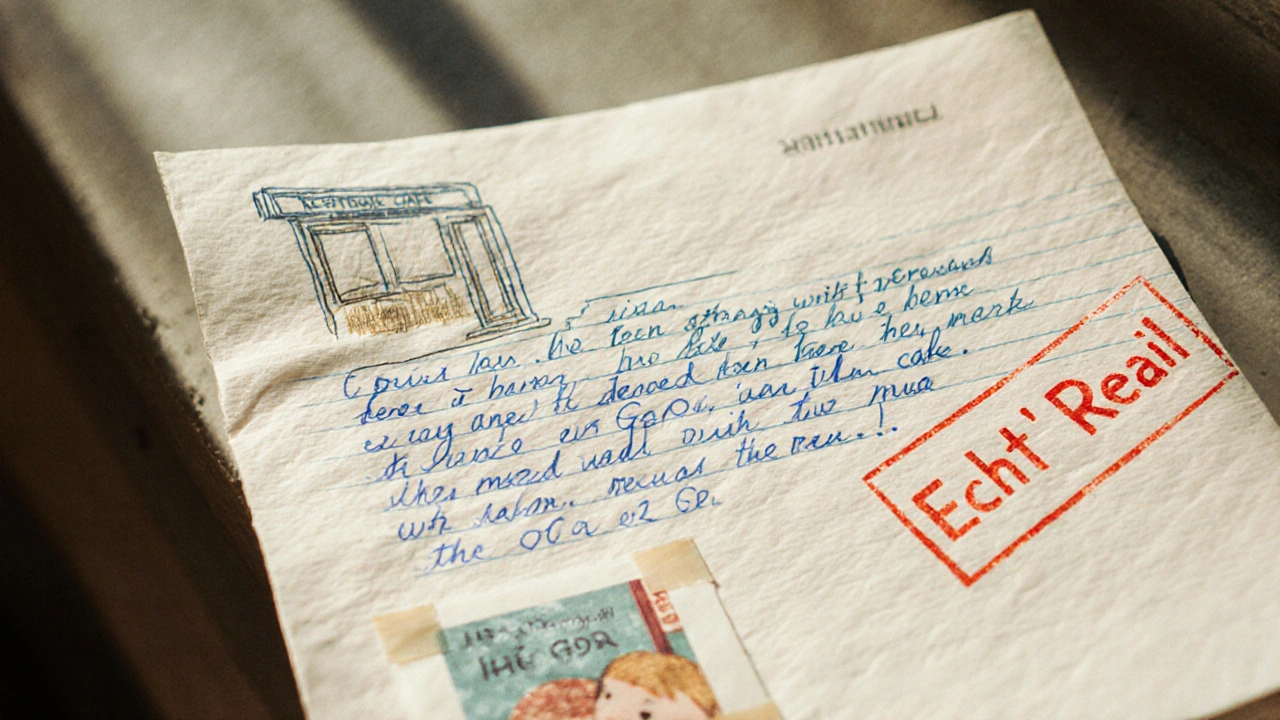
Das Motivationsschreiben - kein Standardtext, sondern deine Geschichte
Ein Motivationsschreiben ist kein Lebenslauf mit Worten. Es ist deine Antwort auf die Frage: Warum du - und nicht jemand anderes?
Die Humboldt-Stiftung sagt es klar: Standardisierte Schreiben erhöhen die Absagequote um 37 Prozent. Das heißt: Wenn du ein Schreiben von der Uni deiner Freundin kopierst, hast du fast keine Chance. Die Auswahlkommissionen lesen Hunderte davon. Sie erkennen Muster, Floskeln, Kopien.
Was funktioniert? Konkrete Beispiele. Erzähl nicht nur, dass du „engagiert“ bist. Erzähle, wie du letztes Jahr in einem Flüchtlingscafé Deutschunterricht gegeben hast - und wie du dabei gemerkt hast, dass Bildungsgerechtigkeit dein Lebensziel ist. Erwähne, dass du das Deutschlandstipendium brauchst, um neben dem Studium noch zwei Jobs zu schaffen, und dass du mit dem Geld endlich die Forschung zu sozialer Mobilität in ländlichen Regionen finanzieren kannst.
Die meisten Stipendien prüfen drei Kriterien: 50 Prozent akademische Leistungen, 30 Prozent soziales Engagement, 20 Prozent Zukunftspotenzial. Das heißt: Du brauchst mindestens eine 2,5 im Durchschnitt - aber das allein reicht nicht. 92 Prozent der Hochschulen verlangen explizit Engagement. Und du musst zeigen, wohin du mit dem Stipendium willst. Nicht nur „Ich will gut abschließen“, sondern „Ich will nach dem Master in eine Bildungs-NGO gehen und Bildungsprogramme für Kinder mit Migrationshintergrund entwickeln“.
Ein Erfolgsbeispiel: Steffen Schroeder hat 2025 das Gothaer Bibliotheksstipendium bekommen. Sein Schreiben fing nicht mit „Sehr geehrte Damen und Herren“ an, sondern mit: „Als ich mit 14 Jahren das erste Mal in der städtischen Bibliothek einen Band über die Geschichte der DDR gelesen habe, wusste ich nicht, dass diese Bücher eines Tages mein Berufsleben bestimmen würden.“ Das war persönlich. Das war echt. Und das hat ihn aus der Masse herausgehoben.
Was viele vergessen: Kleine Stipendien, große Wirkung
Die großen Programme wie das Deutschlandstipendium sind bekannt - aber auch extrem konkurrenzintensiv. Im Jahr 2024 wurden 33.033 Stipendien vergeben, finanziert von 8.936 privaten Förderern. Das klingt viel - aber verteilt auf über 300 Hochschulen, sind das oft nur 5 bis 10 Plätze pro Uni.
Dagegen gibt es Hunderte kleine Stiftungen: die Stiftung der deutschen Wirtschaft, die Kulturstiftung der Länder, lokale Sparkassen, Kirchengemeinden, Vereine. Die meisten haben kein eigenes Internetportal. Sie werben in der Uni-Bibliothek, im Studentenwerk oder auf Aushängen in der Mensa. Ein Stipendium von 300 Euro im Monat von deiner örtlichen Handwerkskammer mag nicht viel klingen - aber wenn du damit deine Miete decken kannst, ist es dein Rettungsanker.
Gehe in dein Studentenwerk. Frag bei deinem Fachbereich nach. Sprich mit älteren Studierenden. Oft wissen sie von Stipendien, die noch nie online standen. Ein Student aus Bremen hat 2024 ein 500-Euro-Stipendium von der örtlichen Buchhandlung bekommen - nur weil er im Gespräch erwähnte, dass er Bücher über Bildungsgerechtigkeit sammelt. Kein Antrag, kein Portal. Nur ein offenes Gespräch.

Was die Datenbanken nicht sagen: Die systematischen Lücken
Die meisten Stipendiendatenbanken sind nicht perfekt. Sie vernachlässigen systematisch Studierende mit familiären Verpflichtungen. Nur 8 Prozent der gelisteten Programme erwähnen flexible Laufzeiten. Wenn du ein Kind hast, deine Eltern pflegst oder Teilzeit studierst, wirst du oft ausgeschlossen - nicht weil du nicht gut bist, sondern weil die Programme auf 12-Monats-Studierende ausgelegt sind.
Auch die Digitalisierung bringt neue Probleme. Die DAAD plant bis März 2025 KI-gestützte Matching-Algorithmen - das klingt toll. Aber Experten warnen: Solche Systeme lernen aus den Daten der letzten Jahre. Und wenn in der Vergangenheit nur Studierende mit hohen Noten und ohne Kinder gefördert wurden, dann wird die KI das wiederholen. Sie fördert nicht Chancengleichheit - sie verfestigt bestehende Muster.
Und dann gibt es die Premium-Filter. Bei e-fellows.net und anderen Plattformen kannst du für 10 Euro im Monat auf „exklusive Angebote“ zugreifen. Aber wer zahlt? Meistens die, die es sich leisten können. Wer kein Geld hat, kann nicht bezahlen - und verpasst damit die besten Chancen. Das ist kein Fehler, das ist ein Systemproblem.
Was du jetzt tun kannst
Starte nicht mit einer Datenbank. Starte mit dir selbst.
- Erstelle eine Liste deiner Stärken: Welche Noten hast du? Welche Engagements hast du? Welche Erfahrungen hast du - auch außerhalb der Uni?
- Finde heraus, zu welcher Gruppe du gehörst: Student mit Migrationshintergrund? Alleinerziehend? Aus einer Familie ohne Studienerfahrung? Aus einem ländlichen Gebiet?
- Gehe in drei Datenbanken: e-fellows.net, DAAD und arbeiterkind.de. Filtere nach deinem Profil.
- Suche lokal: Studentenwerk, Fachschaft, Bibliothek, Stadtverwaltung.
- Erstelle eine Fristentabelle mit mindestens vier Wochen Vorlauf für jedes Dokument.
- Schreibe ein Motivationsschreiben für jedes Stipendium - kein Copy-Paste, immer neu, immer persönlich.
Stipendien sind kein Zufall. Sie sind das Ergebnis von Planung, Ehrlichkeit und Beharrlichkeit. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur echt sein. Und du musst anfangen - jetzt. Nicht nächste Woche. Nicht nach den Ferien. Heute.
Wie viele Stipendien gibt es in Deutschland?
Es gibt über 2.000 verschiedene Stipendienprogramme in Deutschland - von kleinen lokalen Stiftungen bis hin zu bundesweiten Förderungen wie dem Deutschlandstipendium. Aber nur etwa 62 Prozent davon sind in zentralen Datenbanken gelistet. Das heißt, viele Angebote findest du nur, wenn du aktiv in deiner Uni, Stadt oder Fachrichtung nachfragst.
Wie viel Geld gibt das Deutschlandstipendium?
Das Deutschlandstipendium gibt monatlich 300 Euro. Die Hälfte (150 Euro) zahlt der Bund, die andere Hälfte kommt von privaten Förderern wie Unternehmen, Stiftungen oder Einzelpersonen. Es wird an über 300 Hochschulen vergeben und ist unabhängig vom Einkommen der Familie.
Brauche ich eine bestimmte Note, um ein Stipendium zu bekommen?
Viele Stipendien verlangen mindestens eine 2,5 im Durchschnitt - besonders das Deutschlandstipendium. Aber die Note ist nur ein Teil. 50 Prozent der Bewertung basiert auf akademischen Leistungen, 30 Prozent auf sozialem Engagement und 20 Prozent auf deinem zukünftigen Potenzial. Du kannst auch mit einer 3,0 ein Stipendium bekommen, wenn du stark in der Gemeinschaft engagiert bist.
Kann ich mehrere Stipendien gleichzeitig bekommen?
Ja, aber nicht immer. Das Deutschlandstipendium kann oft mit anderen Förderungen kombiniert werden - aber manche Stiftungen verbieten das. Prüfe immer die Bedingungen. Einige Stipendien zahlen nur, wenn du kein anderes Einkommen hast. Andere erlauben Kombinationen, solange du nicht mehr als deinen Lebensunterhalt erhältst.
Wie schreibe ich ein gutes Motivationsschreiben?
Schreibe nicht, was du denkst, dass sie hören wollen. Schreibe, was wirklich dich ausmacht. Erzähle eine konkrete Geschichte: Warum du studierst, was dich antreibt, wie du schon geholfen hast. Verknüpfe deine Erfahrungen mit den Zielen des Stipendiums. Vermeide Floskeln wie „Ich bin motiviert“ oder „Ich habe immer gute Noten“. Zeige, nicht sag.
Was mache ich, wenn ich keine Stipendien bekomme?
Suche weiter - aber wechsle die Strategie. Viele verlieren nach drei Absagen. Aber die meisten Stipendien haben nur eine Frist pro Jahr. Wenn du im Winter abgelehnt wurdest, versuche es im Frühjahr mit einem anderen Programm. Sprich mit Professoren, frag im Studentenwerk nach, schau in Fachzeitschriften. Manchmal gibt es Stipendien, die niemand bewirbt - weil sie zu speziell sind. Und genau die sind deine Chance.






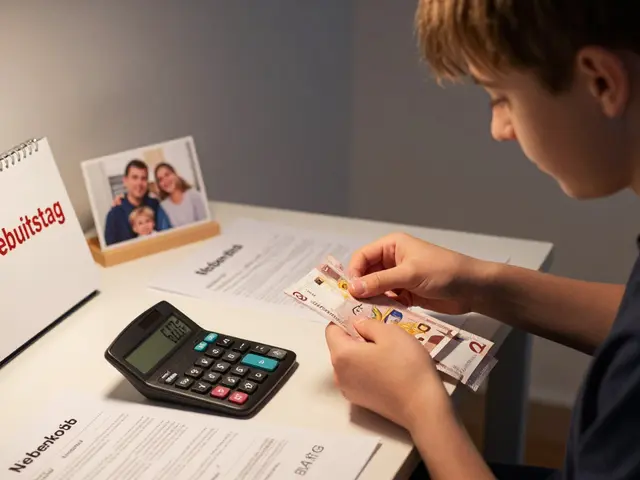
15 Kommentare
Karoline Abrego
Ich hab mich letzte Woche beworben – und schon wieder abgelehnt. Kein Wunder, wenn man so viel Text lesen muss, bevor man was kriegt.
Stefan Johansson
Oh Gott, wieder ein Artikel, der uns erzählt, wie man Stipendien *richtig* sucht. Als ob das nicht jeder weiß. Ich hab 17 Bewerbungen geschrieben, 14 davon mit personalisierten Motivationsschreiben – und trotzdem nur Absagen. Die Systeme sind kaputt, nicht ich. 🤡
Gerhard Lehnhoff
Die DAAD-Datenbank ist nur für Ausländer? Ach echt? Und ich dachte, die sind für alle da. 😂
Und dann kommt noch e-fellows.net mit 10€/Monat Premium-Zugang – also wer arm ist, darf nicht erfolgreich sein. Genialer Kapitalismus. Ich hab 2023 800€ für 'exklusive Angebote' ausgegeben – und bekam ein Stipendium von 150€/Monat. Danke, System.
Alexandra Schneider
ich hab das mit der fristentabelle gemacht und es hat echt geholfen 😊
ich hab mir nen kalender erstellt und jede woche ne erinnerung gesetzt… und dann hab ich tatsächlich was bekommen!!
es is nich perfekt aber es hat funktioniert 🤗
Michelle Fritz
Wer sich nicht mindestens 2,0 hat und ein Motivationsschreiben schreibt wie ein Nobelpreisträger, hat keine Chance. Das ist kein Systemversagen, das ist Leistungsschwäche. Und wer auf lokale Stipendien hofft, sollte lieber in den Osten ziehen – da gibt’s wenigstens noch echte Menschen.
Anton Deckman
Ich hab vor drei Jahren kein Stipendium bekommen – weil ich dachte, ich müsste perfekt sein. Dann hab ich einfach angefangen, mit Leuten zu reden. Ein Professor hat mir von einem Stipendium erzählt, das niemand kannte – 300€ von der lokalen Bäckerei, weil ich mal in ihrem Laden Bücher über Bildung verteilt hab. Es war nicht viel – aber es hat mir das Leben gerettet. Ihr müsst nicht alles perfekt machen. Ihr müsst nur anfangen. Und reden. 😊
Jamie Baeyens
Stipendien sind die letzte Illusion des meritokratischen Traums – ein Märchen, das den Armen sagt: 'Du bist nicht arm, du bist faul.'
Die Datenbanken sind nicht unvollständig – sie sind systematisch ausgerichtet auf die, die schon gewinnen. Wer kein Geld hat, hat keine Zeit. Wer keine Zeit hat, hat keine Netzwerke. Wer keine Netzwerke hat, wird nicht gesehen. Die KI, die du erwähnst? Sie wird nicht gerecht – sie wird nur effizienter im Ausschließen. Du kannst nicht 'echt sein', wenn du jeden Tag arbeiten musst, um zu überleben. Und du kannst nicht 'planen', wenn du nicht weißt, ob du morgen noch eine Wohnung hast.
sylvia Schilling
Ich hab ein Kind, studiere Teilzeit und arbeite 20h/Woche. Ich hab 37 Stipendien angesehen – 35 davon haben 'vollzeitstudium' vorausgesetzt. Keine Flexibilität. Keine Rücksicht. Keine Menschlichkeit. Ich hab mir ein Motivationsschreiben geschrieben, in dem ich erzählt habe, wie ich mit meinem Sohn um 5 Uhr morgens lerne, während er schläft. Ich hab’s abgeschickt. Keine Antwort. Nicht mal eine Absage. Nur Stille. Und jetzt? Ich bin müde. Nicht von der Arbeit. Von dem System.
Elien De Sutter
Ich bin aus Belgien, hab hier studiert und hab ein Stipendium von einer kleinen Kirchengemeinde in Köln gekriegt – weil ich beim Kirchenkaffee erwähnt hab, dass ich Bücher für Flüchtlingskinder sammle. Kein Portal. Kein Formular. Nur ein Gespräch. Ich find’s schön, dass es noch so was gibt. Manchmal reicht ein offenes Ohr. 🌱
Sabine Kettschau
Das Deutschlandstipendium ist eine Farce. 300 Euro? Für Berlin? Das reicht nicht mal für die Miete, wenn du nicht mit 5 Leuten in einer WG wohnst. Und die Hochschulen vergeben es an die, die schon die besten Noten haben – also die, die von klein auf Privatunterricht hatten. Wer von außen kommt, hat keine Chance. Und dann erzählst du noch von 'Ehrlichkeit'? Du brauchst nicht ehrlich zu sein – du brauchst einen Vater, der dir sagt, wie man einen Lebenslauf schreibt. Das ist kein System. Das ist ein Klub.
Max Weekley
Ich hab die DAAD-Datenbank benutzt… und dann gesehen, dass ich nicht mal 'international' bin, weil ich aus Deutschland komm. 🤦♂️
Christoffer Sundby
Ich hab in Norwegen studiert – dort gibt’s keine Stipendien, weil alle Studierenden staatlich unterstützt werden. Aber ich hab gelernt: Wenn du dich auf Systeme verlässt, wirst du immer hinterher sein. Die echten Chancen liegen in den kleinen Gesprächen. Frag deine Kommilitonen. Frag deine Dozenten. Frag den Bibliothekar. Die besten Tipps kommen nicht von Datenbanken – sie kommen von Menschen, die schon da waren.
Stefan Sobeck
hab gestern mit nem prof geredet und der hat mir von nem stippendium erzählt das nich mal online steht… 400 euro monatlich von ner alten dame aus dem ort… ich hab ihr nur gesagt, dass ich gerne über soziale ungleichheit schreib… und sie hat mich eingeladen… jetzt krieg ich geld und kaffee 😅
Francine Ott
Es ist bemerkenswert, wie stark die strukturellen Barrieren in diesem System verankert sind – insbesondere hinsichtlich der digitalen Exklusion und der sozialen Reproduktion von Ungleichheit. Die Forderung nach 'Ehrlichkeit' im Motivationsschreiben ist paradox, wenn die Infrastruktur der Bewerbung selbst von sozialer Kapitalisierung abhängt. Ich schlage vor, dass wir nicht nur die Bewerber:innen verändern, sondern das System selbst – durch Transparenz, partizipative Gestaltung und den Abbau von monetären Zugangshürden.
Anton Deckman
Ich hab vor zwei Jahren das gleiche Gefühl wie Sylvia – müde. Aber ich hab nicht aufgehört. Ich hab in der Uni-Bibliothek einen Zettel aufgehängt: 'Ich suche Leute, die über Bildungsgerechtigkeit schreiben. Wer hat ein Stipendium, das keiner kennt?' – und eine Frau aus der Nachbarschaft hat mich kontaktiert. Sie hat 20 Jahre lang Stipendien für Kinder von Pflegeeltern vergeben – ohne Webseite. Nur per Post. Ich hab sie getroffen. Sie hat mir 500 Euro gegeben. Nicht weil ich perfekt war. Weil ich nicht aufgegeben habe. Ihr müsst nicht alles wissen. Ihr müsst nur nicht aufhören.