Wasserqualität messen: Schüler als Umweltforscher
Stell dir vor, du gehst nicht in die Schule, um Mathe zu üben oder einen Aufsatz zu schreiben, sondern um das Wasser vor deiner Haustür zu untersuchen. Du nimmst eine Probe aus dem Bach hinter dem Sportplatz, misst den pH-Wert, prüfst, ob das Wasser leitfähig ist, und fragst dich: Ist das sicher? Ist das normal? Das ist nicht Science-Fiction - das passiert jeden Tag in über 2.500 deutschen Schulen. Schülerinnen und Schüler werden zu echten Umweltforschern, ohne Laborweißkittel oder teure Geräte. Sie lernen, wie man Wasser analysiert - und dabei verstehen, was wirklich in unserer Umwelt vor sich geht.
Diese Art von Lernen nennt sich citizen science - Bürgerforschung. Und in der Schule funktioniert sie besonders gut, weil sie nicht abstrakt bleibt. Es geht nicht um das Auswendiglernen von Formeln, sondern um echte Fragen: Warum ist das Wasser im Teich trüb? Warum schmeckt es anders als aus dem Hahn? Wer hat das Wasser verändert? Die Antworten finden die Schüler selbst - mit einfachen Werkzeugen, die kaum mehr kosten als ein Kasten Milch.
Was genau messen Schüler eigentlich?
Nicht alles. Aber das Wichtige. In der Schule geht es nicht darum, alle 55 Parameter der Trinkwasserverordnung zu prüfen - das wäre unmöglich und überfordert. Stattdessen konzentrieren sich die Experimente auf vier bis sechs messbare Größen, die schon viel über die Qualität verraten:
- pH-Wert: Zeigt, ob das Wasser sauer oder basisch ist. Normalerweise liegt er zwischen 6,5 und 8,5. Ein Wert unter 5,5 - wie bei einem Schüler aus der 7. Klasse, der sein Schulhof-Teich gemessen hat - deutet auf Versauerung hin, vielleicht durch sauren Regen oder Abwässer.
- Leitfähigkeit: Gemessen in Mikrosiemens pro Zentimeter (µS/cm). Je höher der Wert, desto mehr gelöste Stoffe sind im Wasser - Salze, Mineralien, aber auch Schadstoffe. Ein Wert über 1.500 µS/cm ist oft ein Warnsignal.
- Temperatur: Nicht nur, weil es cool ist, das zu messen. Warmes Wasser hält weniger Sauerstoff - das kann Fische töten. Ein Anstieg um nur 3-4 °C über die Umgebungstemperatur kann ein Zeichen für Abwasserzufuhr sein.
- Wasserhärte: Bestimmt mit Seifenlösung oder speziellen Testkästen (wie Aquamerck). Weiches Wasser (unter 8,4 °dH) löst Seife leichter, hartes Wasser (über 14 °dH) hinterlässt Kalk. Beides ist normal - aber in Kombination mit anderen Werten sagt es etwas über die geologische Herkunft oder Verschmutzung.
- Sichtbare Verunreinigungen: Algen, Ölfilme, Schlamm, Plastik. Diese sehen alle aus wie Müll - und das sind sie oft auch. Schüler lernen, dass manche Probleme nicht mit einem Messgerät, sondern mit den Augen erkannt werden.
Diese Messungen sind nicht perfekt. Ein pH-Meter aus der Schule kann um ±0,3 Einheiten abweichen. Das klingt nach viel - aber für den Einstieg reicht es. Es geht nicht um Genauigkeit, sondern um Muster. Wenn alle Gruppen in der Klasse das gleiche Wasser messen und fast alle denselben niedrigen pH-Wert bekommen, dann ist das kein Zufall. Das ist ein Hinweis.
Wie funktioniert das in der Praxis?
Es beginnt nicht mit dem Messgerät. Es beginnt mit der Frage.
Ein Lehrer bringt eine Flasche Wasser aus dem Schulgarten mit. Ein anderer hat eine Probe vom Fluss am Stadtrand. Die Schüler stellen Hypothesen auf: „Das Wasser ist sauber, weil es klar ist.“ „Der Bach ist schmutzig, weil er nach Moder riecht.“ Dann geht’s los: Die Gruppen bekommen je ein Becherglas, einen Tropfer, ein Thermometer, Teststreifen oder ein digitales pH-Meter. Sie lernen, wie man das Gerät kalibriert - und warum das so wichtig ist. Viele Lehrkräfte berichten, dass 37 % der Schüler anfangs Probleme mit der Kalibrierung haben. Aber genau das ist der Lernpunkt: Messfehler sind normal. Wichtig ist, sie zu erkennen.
Die Materialkosten liegen bei etwa 12,50 Euro pro Stunde - das ist weniger als ein Kino-Ticket. Die meisten Schulen nutzen Programme wie „Lab in a Drop®“ von Hamburg Wasser, das mit weniger als 0,05 Milliliter Chemikalien pro Test auskommt. Das ist nicht nur günstig, sondern auch sicher. Kein Schüler muss mit Säuren oder giftigen Lösungen hantieren.
Die Ergebnisse werden in Tabellen eingetragen, verglichen, diskutiert. Wer hat das sauberste Wasser? Wer hat das schlimmste? Und warum? Die Schüler lernen, dass Wasser nicht „gut“ oder „schlecht“ ist - sondern kontextabhängig. Ein Bach in der Landschaft kann natürlicherweise härter sein als Leitungswasser. Ein Teich mit Algen ist nicht automatisch verseucht - aber wenn er zusätzlich sauer ist und keine Fische mehr hat, dann ist etwas falsch.

Was ist anders als im Labor?
Professionelle Labore analysieren 24 oder mehr Parameter: Schwermetalle wie Blei oder Quecksilber, Bakterien wie E. coli, Nitrat, Pestizide, Mikroplastik. Das kostet 98 Euro pro Probe. Schulen können das nicht. Und das ist auch nicht der Punkt.
Die Schule ist kein Ersatz für das Labor - sie ist der Einstieg. Sie zeigt: Du kannst selbst forschen. Du kannst Daten sammeln. Du kannst etwas verändern. Ein Schüler, der feststellt, dass sein Schulhof-Teich einen pH-Wert von 5,2 hat, wird nicht einfach weitergehen. Er fragt: Warum? Wer hat das verursacht? Kann ich das ändern?
Das ist der Unterschied. Im Labor geht es um Genauigkeit. In der Schule geht es um Neugier.
Kritiker warnen zu Recht: Wer glaubt, mit pH-Streifen und einem Thermometer die gesamte Wasserqualität beurteilen zu können, läuft Gefahr, falsche Sicherheit zu entwickeln. Dr. Petra Winkler vom Umweltbundesamt sagt es klar: „Schulische Analysen können zu falschen Sicherheiten führen.“ Aber genau das macht das Konzept so stark - weil es diese Grenzen offenlegt. Lehrer sprechen mit den Schülern darüber: „Wir messen nur das, was wir mit einfachen Mitteln sehen können. Es gibt noch viel mehr, das unsichtbar ist.“ Das ist keine Schwäche - das ist Wissenschaft.
Warum funktioniert das so gut?
Studien zeigen: Schüler, die Wasser messen, verbessern ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse um durchschnittlich 37 %. Das ist mehr als bei klassischen Theorie-Unterricht. Warum? Weil sie nicht zuhören - sie tun etwas. Sie fühlen, sehen, riechen, messen, diskutieren. Sie werden zu Experten - nicht weil der Lehrer es sagt, sondern weil sie es selbst herausgefunden haben.
Ein Bericht der Siemens-Stiftung bewertet ihre „Wasser 3“-Anleitung mit 4,7 von 5 Sternen. Lehrer loben die klaren Anleitungen, die selbst ohne Vorkenntnisse funktionieren. Schüler berichten: „Ich dachte, Wasser ist nur Wasser. Jetzt weiß ich, dass es unterschiedlich sein kann.“
Und es geht weiter. Seit 2022 gibt es Apps, mit denen Schüler ihre Messwerte fotografieren, dokumentieren und in eine digitale Karte eintragen. Hamburg Wasser hat sogar ein Modul für Mikroplastik hinzugefügt - mit einem einfachen Filter und einer Lupe. Schüler filtern Wasserproben, zählen Plastikpartikel unter der Lupe und vergleichen ihre Ergebnisse mit anderen Schulen. Das ist nicht nur Bildung - das ist Bürgerforschung auf dem Niveau einer wissenschaftlichen Studie.
Was braucht man, um das in der Schule umzusetzen?
Es ist einfacher, als du denkst. Hier ist die Grundausstattung pro Schülergruppe:
- 5 Bechergläser (50 ml)
- 10 PE-Flaschen mit Tropfverschluss (100 ml)
- 2 Erlenmeyerkolben (200 ml)
- 1 pH-Meter oder pH-Teststreifen (Bereich 0-14)
- 1 Leitfähigkeitsmessgerät (0-2000 µS/cm)
- 1 Thermometer (-10°C bis 110°C)
- Seifenlösung für Wasserhärte (Boutron-Boudet-Methode)
- Referenzproben (z. B. destilliertes Wasser, Leitungswasser)
Die meisten Schulen nutzen fertige Kits von Anbietern wie Siemens-Stiftung, HAMBURG WASSER oder Merck. Die Materialien sind so gestaltet, dass sie in einer Unterrichtsstunde durchgeführt werden können - inklusive Vorbereitung, Messung und Auswertung. Einige Lehrer erstellen ihre eigenen Anleitungen - aber oft mit schlechteren Ergebnissen. Eine Umfrage ergab: Selbstgemachte Materialien bekommen im Durchschnitt nur 2,8 von 5 Sternen für Klarheit. Professionelle Anleitungen wie von der Siemens-Stiftung erreichen 4,5.
Wichtig ist: Drei Unterrichtsstunden sollten vorher eingeplant werden - für die Einführung, die Sicherheit, die Kalibrierung. Kein Schüler sollte ein Messgerät benutzen, ohne zu wissen, wie man es richtig hält. Und: Die Proben müssen sauber entnommen werden. Ein Becher, der vorher für Cola benutzt wurde, verfälscht die Ergebnisse.

Was kommt als Nächstes?
Die Zukunft ist digital, vernetzt und verpflichtend. Die Kultusministerkonferenz plant bis 2025, Wasserqualitätsmessungen in den bundesweiten MINT-Standard aufzunehmen. Das bedeutet: In allen Bundesländern wird das irgendwann zum festen Bestandteil des Unterrichts. In Berlin und Hamburg ist es schon jetzt verankert.
Und die Zusammenarbeit mit Wasserwerken wächst. 68 % der Schulkooperationen werden von kommunalen Versorgern initiiert - nicht von den Schulen allein. Sie stellen Materialien, Schulungen und Experten zur Verfügung. Das Fraunhofer IGB bietet kostenlose Online-Schulungen für Lehrer an - 120 Pädagogen pro Quartal nehmen teil.
Die Corona-Pandemie hat diese Projekte zwar um 42 % zurückgeworfen - aber auch digitale Alternativen hervorgebracht. Virtuelle Labore, interaktive Apps, Online-Datenbanken - sie ergänzen die praktische Arbeit, ersetzen sie aber nicht. Denn das Wichtigste bleibt: Die Hand, die das Messgerät hält. Das Auge, das den Algenfilm sieht. Der Kopf, der fragt: „Warum?“
Frequently Asked Questions
Kann man Wasserqualität wirklich mit einfachen Mitteln messen?
Ja - aber nur begrenzt. Schüler messen pH-Wert, Leitfähigkeit, Temperatur und Wasserhärte mit einfachen Geräten. Das reicht, um grobe Veränderungen zu erkennen, wie Versauerung oder Verschmutzung. Aber sie können keine Schwermetalle, Bakterien oder Mikroplastik nachweisen - dafür braucht man ein Labor. Die Schule zeigt: Du kannst anfangen, selbst zu forschen. Das ist der erste Schritt.
Wie teuer ist das für eine Schule?
Pro Schülergruppe und Stunde liegen die Materialkosten bei durchschnittlich 12,50 Euro. Das beinhaltet Teststreifen, Messgeräte und Chemikalien. Viele Schulen nutzen kostenlose Kits von Wasserwerken wie Hamburg Wasser oder der Siemens-Stiftung. Die größte Investition ist die Zeit - für die Vorbereitung und Schulung der Lehrkräfte.
Warum messen Schüler nicht auch Bakterien?
Weil das zu komplex und gefährlich wäre. Bakterien nachzuweisen braucht Nährböden, Inkubatoren und mehrere Tage Wartezeit - und es geht um Gesundheitsrisiken. In der Schule geht es um Sicherheit und Verständnis. Man lernt, dass es unsichtbare Schadstoffe gibt - und dass man dafür Experten braucht. Das ist eine wichtige Lektion.
Welche Vorteile hat das für Schüler?
82 % der befragten Schüler sagen, dass sie durch diese Experimente ihr Interesse an Naturwissenschaften gesteigert haben. Sie lernen, wie Wissenschaft funktioniert: Fragen stellen, Daten sammeln, Fehler machen, korrigieren, diskutieren. Das baut nicht nur Wissen auf - es baut Selbstvertrauen auf.
Ist das nur für Naturwissenschaften?
Nein. Wasserqualität verbindet Chemie, Biologie, Geografie, Mathematik und sogar Ethik. Wer das Wasser misst, lernt auch, wie menschliche Aktivitäten die Umwelt beeinflussen. Das ist Umweltbildung - und die gehört in jedes Fach.
Was bleibt?
Wasser ist nicht nur H2O. Es ist Geschichte. Es ist Politik. Es ist Verantwortung. Und es ist ein Spiegel dessen, wie wir mit der Welt umgehen. Wenn Schüler lernen, es zu messen, lernen sie, es zu verstehen. Und wenn sie es verstehen, fangen sie an, es zu schützen.
Das ist der größte Erfolg dieser Methode. Nicht die Messwerte. Nicht die Geräte. Sondern die Frage, die am Ende bleibt: „Was kann ich tun?“


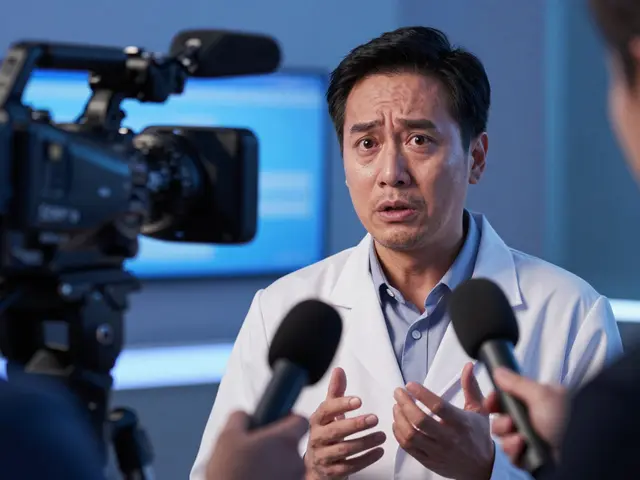



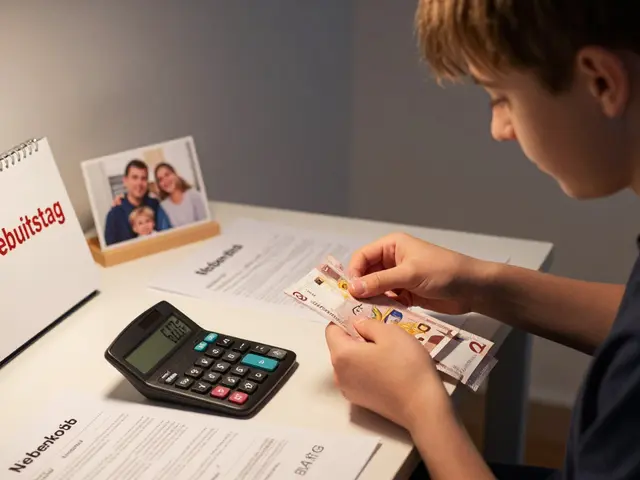
15 Kommentare
Susanne Lübcke
Ich find’s irgendwie schön, dass Kinder jetzt selbst rausgehen und nachdenken, statt nur aus Büchern zu lernen. Wasser ist ja nicht nur H2O – es trägt die Geschichte von uns allen. Manchmal braucht’s nur einen kleinen Blick, um zu merken, dass was nicht stimmt.
Und das ist doch der erste Schritt zur Verantwortung, oder?
karla S.G
Na super, jetzt sollen Kinder auch noch Umweltaktivisten spielen? Wer bezahlt das? Und warum gibt’s nicht einfach mehr Kontrollen von den Behörden statt dass wir Lehrer zu Labortechnikern machen? Das ist doch nur Gutmenschentum mit Messstreifen.
Und wer kontrolliert, ob die Kids die Geräte nicht einfach falsch benutzen? Ich sag nur: falsche Sicherheit.
Stefan Lohr
Die Methode ist pragmatisch. Schüler lernen nicht nur Messwerte, sondern den Umgang mit Unsicherheit. Ein pH-Wert von 5,2 ist kein Beweis für Verschmutzung, aber ein Anhaltspunkt. Und genau das ist der Kern der Wissenschaft: Hypothesen aufstellen, nicht abschließend urteilen.
Die Kritik an der Genauigkeit ist berechtigt, aber irrelevant für den Bildungszweck.
Elin Lim
Wasser misst man nicht. Man beobachtet es.
Und dann fragt man sich, warum es so ist.
Das ist alles.
INGEBORG RIEDMAIER
Es ist zu begrüßen, dass Bildungsinitiativen im Sinne der Nachhaltigkeitsziele der UN-2030-Agenda implementiert werden. Die Integration von Citizen Science in den curricularen Rahmen der MINT-Bildung stellt eine evidenzbasierte pädagogische Innovation dar, die kognitive Dissonanzen reduziert und die Entwicklung von systemischem Denken fördert.
Die verwendeten Instrumente, insbesondere die von Hamburg Wasser und der Siemens-Stiftung, entsprechen den Anforderungen an Validität und Reproduzierbarkeit in der Schulpraxis.
Koen Punt
Interessant, dass hier von "einfachen Mitteln" gesprochen wird, während gleichzeitig 12,50 Euro pro Schülerstunde als "günstig" bezeichnet werden. Wer hat das bezahlt? Wer hat die Schulen dazu verpflichtet? Und wer hat die Lehrer dafür ausgebildet, dass sie nicht einfach nur falsche Daten produzieren?
Das ist keine Bildung. Das ist eine performative Geste, die den Eindruck von Engagement erzeugt, ohne strukturelle Veränderung zu bewirken.
Harry Hausverstand
Ich hab das mit meiner Tochter letzte Woche gemacht – Bach hinter der Schule. pH 6,8, Leitfähigkeit 850 µS/cm, kein Algenfilm, aber ein bisschen Plastik. Sie hat gesagt: "Papa, das ist doch nicht normal, oder?"
Und ich hab ihr geantwortet: Nein. Nicht normal. Aber wir können was tun.
Das war mehr wert als ein ganzer Biologie-Test.
Stephan Lepage
Leute, ich hab das letztes Jahr auch gemacht mit meiner Klasse und wir haben nen Bach gemessen der nach faulen Eiern gerochen hat und pH 4,9 hatte und keiner hat was gesagt weil alle dachten das ist normal weil es halt ein Bach ist
und dann ham wir rausgefunden dass da ne alte Abwasserleitung rausläuft seit 1978 und keiner hat es gecheckt
jetzt bauen die das um
also ja es funktioniert
und ja es ist einfach
und ja es zählt
Erica Schwarz
Ich war Lehrerin in einer Grundschule in Brandenburg und wir haben das mit den Jüngsten gemacht – 8 Jahre alt. Sie haben mit Seife Wasserhärte gemessen und waren total begeistert. Einer hat gesagt: "Mein Papa sagt, das Wasser ist weich, weil er in der Badewanne nie Kalk sieht."
Das ist Bildung. Nicht auswendiglernen. Sondern verstehen.
Und das ist es, was bleibt.
Oliver Sy
Als Ingenieur und ehemaliger Schulprojektleiter: Die hier beschriebene Methode ist ein Paradebeispiel für authentisches Lernen. Die verwendeten Messgeräte haben eine nachweisbare Genauigkeit von ±5 %, was für den didaktischen Kontext absolut ausreichend ist. Die digitale Vernetzung über die Apps ermöglicht sogar eine aggregierte Datenerhebung auf Landesebene – eine echte Bürgerwissenschaft.
Ich empfehle dringend die Nutzung der Siemens-Stiftung’s „Wasser 3“-Kits – sie sind strukturiert, sicher und lernorientiert. 💡
Steffen Ebbesen
Ein pH-Meter für 12 Euro? Und das soll Wissenschaft sein? In der echten Forschung misst man mit HPLC und Massenspektrometrie. Das hier ist ein Theaterstück für Kinder, das Eltern und Lehrer glauben machen soll, sie würden etwas tun.
Und dann wundern sie sich, warum die Jugendlichen später keine Naturwissenschaften studieren – weil sie mit Halbwissen aufwachsen.
Stephan Brass
Also ich find das total übertrieben. Wer braucht das? Die Leute in der Stadt haben doch Leitungswasser. Die Bauern haben ihre Felder. Wer misst denn den Bach hinterm Sportplatz? Niemand. Und wenn doch, dann macht das doch keinen Unterschied.
Und die ganzen Apps? Nee. Das ist nur digitales Geschwafel. Wir hatten das mal in der Schule – die Kids haben die Messwerte einfach erfunden, weil sie keine Lust hatten.
Und jetzt wird das bundesweit verpflichtet? Boah.
Sven Schoop
WAS IST DAS FÜR EIN SCHWACHSINN?!? Wer sagt, dass Schüler mit pH-Streifen irgendetwas verstehen?!? Sie messen, aber sie wissen nicht, was sie messen! Und dann wird das als "Wissenschaft" vermarktet?!? Das ist eine gefährliche Täuschung! Wer kontrolliert, dass die Geräte nicht verfälscht werden?!? Wer sagt, dass die Lehrer nicht einfach die Ergebnisse vorgeben?!? Das ist kein Lernen – das ist ein gefälschter Eindruck von Bildung!!!
Markus Fritsche
Ich hab als Kind auch so was gemacht – mit einem alten pH-Streifen aus der Apotheke und einem Thermometer aus der Küche.
Wir haben den Teich in der Nachbarschaft gemessen – und da war alles ok.
Aber ich hab nie vergessen, wie ich das Gefühl hatte, dass ich etwas sehe, was andere nicht sehen.
Das war der Moment, in dem ich verstanden hab, dass Wissen nicht nur in Büchern ist.
Und das ist mehr wert als alle Noten der Welt.
Frank Wöckener
Wieder so ein Projekt, das nur deshalb existiert, weil irgendwer im Bildungsministerium mal was "nachhaltig" gesagt hat. Keine Ahnung, wer das konzipiert hat, aber es ist ein klassischer Fall von "Bildung als Selbstzweck".
Die Kinder lernen nicht, wie man Wasser analysiert – sie lernen, wie man die richtigen Antworten gibt, damit der Lehrer zufrieden ist.
Und die Eltern? Die posten Fotos davon auf Instagram. Und glauben, sie hätten etwas Gutes getan.
Die echte Umweltkrise wird nicht mit pH-Streifen gelöst.