Stell dir vor, du bist Studentin und hast eine Sehbehinderung. Du öffnest das Lernmaterial deiner Professorin - doch der PDF-Ordner ist ein undurchsichtiges Durcheinander aus Bildern ohne Text, Videos ohne Untertitel und Links, die nur als „hier klicken“ erscheinen. Du brauchst eine Bildschirmlese-Software, aber die kann nichts mit dem Material anfangen. Du sitzt da. Alle anderen arbeiten. Du nicht. Das ist kein Einzelfall. In Deutschland haben 16 Prozent der Studierenden eine oder mehrere studienerschwerende Gesundheitsbeeinträchtigungen. Das ist fast jeder Sechste. Und das sind nur die, die sich gemeldet haben.
Was bedeutet barrierefreie digitale Lehre wirklich?
Barrierefreiheit im Unterricht ist nicht nur ein juristischer Begriff. Es geht nicht darum, irgendwelche Sonderregeln für wenige zu machen. Es geht darum, dass jeder - egal ob mit oder ohne Behinderung - die gleiche Chance hat, zu lernen. Das bedeutet: Ein Mensch mit Sehbehinderung muss mit einer Sprachausgabe genau so viel verstehen wie jemand, der einfach nur schnell scrollt. Ein Mensch mit motorischer Einschränkung muss alles mit der Tastatur bedienen können - nicht nur mit der Maus. Und jemand mit kognitiver Beeinträchtigung braucht klare Strukturen, einfache Sprache und keine überladenen Seiten.Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 hat das klar festgelegt: Bildung ist ein Menschenrecht. Und in Deutschland ist das seit 2009 verbindlich. Die rechtliche Grundlage für digitale Inhalte ist die BITV 2.0 - die Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung. Sie orientiert sich an den WCAG 2.1. Aber hier ist der Knackpunkt: Ab 2026 gilt in der EU die neue Version, WCAG 2.2. Und Experten sagen: Wer heute noch mit 2.1 arbeitet, ist schon veraltet. Die Technik entwickelt sich. Die Bedarfe der Lernenden auch. Wer jetzt nicht anfängt, baut Barrieren in seine Lehre ein - und das ist nicht nur unfair, es wird auch rechtlich riskant.
Was braucht ein barrierefreier Lerninhalt? Die 5 Säulen
Es gibt keine magische Formel. Aber es gibt fünf Grundpfeiler, die jeder digitale Lerninhalt erfüllen muss, wenn er wirklich für alle funktionieren soll.- Kontrast und Lesbarkeit: Text muss von Hintergrund abgehoben sein. Mindestens 4,5:1 Kontrastverhältnis für normalen Text. Ein grauer Text auf weißem Hintergrund mag elegant wirken - aber für Menschen mit Sehschwäche ist er unsichtbar. Und ja, das gilt auch für PowerPoint-Folien und PDFs.
- Zoomen ohne Verlust: Jede Seite muss sich auf 200 Prozent vergrößern lassen, ohne dass Text abgeschnitten wird oder Inhalte übereinander laufen. Das ist kein Bonus. Das ist Pflicht. Wer das nicht einhält, schließt Menschen mit Sehbehinderung oder Leseproblemen aus.
- Alternativtexte für Bilder: Ein Bild von einer Formel, einem Diagramm oder einer Person - ohne Textbeschreibung - ist für Bildschirmleser ein schwarzes Loch. „Bild 1“ reicht nicht. Schreibe: „Diagramm zeigt den Anstieg der Studierenden mit psychischen Erkrankungen von 2018 bis 2024 - von 48 auf 65 Prozent.“
- Untertitel und Transkripte: Videos ohne Untertitel sind für Menschen mit Hörbehinderung unzugänglich. Aber auch für Menschen mit Aufmerksamkeitsstörungen oder nicht-deutscher Muttersprache sind Untertitel hilfreich. Und Transkripte? Die braucht jemand, der das Video nicht abspielen kann - etwa wegen langsamer Internetverbindung oder bei Nutzung einer Textausgabe.
- Tastaturbedienung: Kann man alle Funktionen ohne Maus nutzen? Kann man durch Menüs tabben? Kann man Formulare ausfüllen? Wenn nicht, dann ist dein Material für Menschen mit motorischen Einschränkungen oder Nutzenden von Sprachsteuerung unbrauchbar.
Diese Punkte sind nicht „nice to have“. Sie sind die Basis. Und sie sind leichter umzusetzen, als viele denken. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Es geht darum, nicht zu verhindern, dass jemand lernen kann.

Welche Behinderungen gibt es - und wie wirken sie im Lernalltag?
Nicht alle Behinderungen sind sichtbar. Und das macht es so schwer. Die 22. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks zeigt: Die häufigste Beeinträchtigung ist nicht Blindheit oder Rollstuhl. Es sind psychische Erkrankungen - 65 Prozent der betroffenen Studierenden. Angststörungen, Depressionen, Burnout. Diese Menschen brauchen klare Strukturen, überschaubare Aufgaben, vorhersehbare Abläufe. Ein unübersichtlicher Moodle-Kurs mit 20 verschiedenen Links auf einer Seite, die sich alle nach ein paar Tagen ändern, ist für sie überwältigend.13 Prozent haben chronische Erkrankungen - etwa Multiple Sklerose, Diabetes oder chronische Schmerzen. Sie haben schlechte Tage. An manchen Tagen können sie nicht sitzen, nicht lesen, nicht konzentrieren. Barrierefreiheit bedeutet hier: Materialien als Download anbieten, so dass sie sie in Ruhe, in ihrem Tempo, zu Hause nutzen können.
2 Prozent sind blind oder stark sehbehindert. Sie nutzen Screenreader. Die funktionieren nur, wenn die Struktur stimmt: Überschriften, Listen, korrekte Alternativtexte. Ein Bild mit „Bild“ als Beschreibung? Das ist kein Hilfsmittel. Das ist eine Wand.
Und dann gibt es noch die unsichtbaren Barrieren: Menschen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche, mit Dyskalkulie, mit Autismus, mit Sprachbeeinträchtigungen. Sie brauchen klare Sprache. Keine Umschweife. Keine Metaphern. Keine Fachbegriffe ohne Erklärung. Und sie brauchen Zeit. Nicht alle lernen gleich schnell. Barrierefreiheit bedeutet: Flexibilität.
Warum ist Barrierefreiheit mehr als Technik?
Viele denken: „Ich installiere ein Plugin, und schon ist alles barrierefrei.“ Falsch. Barrierefreiheit ist keine Technikfrage. Sie ist eine Haltung.Die Universität Frankfurt sagt es klar: „Eine barrierefreie Lernumgebung erfordert mehr als nur technische Hilfsmittel.“ Es geht um die Art, wie du deine Materialien planst. Es geht darum, ob du dir vorstellst, wie jemand mit einer Handbewegungseinschränkung deine interaktive Übung bedient. Ob du dir vorstellst, wie jemand mit ADHS einen 40-minütigen Video-Vortrag versteht. Ob du dir vorstellst, dass dein Kollege, der seit 20 Jahren an einer Hochschule lehrt, nie gelernt hat, wie man einen PDF-Text für Screenreader vorbereitet.
Barrierefreiheit ist auch eine Frage der Zeit. Wer seine Materialien erst am Ende der Vorlesung aufbereitet, der baut Barrieren ein. Wer sie von Anfang an mitdenkt - beim Skript, beim Video, bei der Präsentation - der spart später Zeit, Ärger und vor allem: er schließt niemanden aus.
Die Thüringer Landesmedienanstalt (TLMB) unterscheidet zwischen drei Arten von Einschränkungen: dauerhafte (z. B. Blindheit), vorübergehende (z. B. gebrochener Arm) und situationsbedingte (z. B. lauter Raum, schlechtes Licht). Das ist der Schlüssel. Barrierefreiheit hilft nicht nur Menschen mit Behinderung. Sie hilft auch dem Studenten, der gerade krank ist. Der Mutter, die mit dem Baby im Arm lernt. Der älteren Person, deren Augen nicht mehr so gut sehen. Sie hilft allen.

Wie fängst du an? Praktische Schritte für Lehrkräfte
Du musst nicht alles auf einmal perfekt machen. Aber du musst anfangen. Hier sind konkrete Schritte, die du heute umsetzen kannst:- PDFs überprüfen: Öffne dein PDF mit Adobe Acrobat. Gehe zu „Werkzeuge“ > „Barrierefreiheit“ > „Barrierefreiheit prüfen“. Die Software zeigt dir, wo Alternativtexte fehlen oder Überschriften nicht richtig formatiert sind.
- Untertitel für Videos: Nutze YouTube oder OpenShot, um automatisch Untertitel zu generieren - und dann korrigiere sie. Automatische Tools machen Fehler, aber sie sind ein guter Anfang.
- Farben prüfen: Nutze kostenlose Tools wie WebAIM Contrast Checker. Gib die Farben deiner Text- und Hintergrundfarbe ein - und schau, ob der Kontrast mindestens 4,5:1 beträgt.
- Struktur mit Überschriften: Nutze in Word oder Google Docs immer die korrekten Überschriften (H1, H2, H3). Kein Fettdruck als Ersatz. Screenreader erkennen nur echte Überschriften.
- Links beschreiben: Schreibe nicht „hier klicken“. Schreibe „Download des Übungsblatts zur Vorlesung 5“.
- Materialien als Download anbieten: Nicht nur als Online-Video oder interaktive Seite. Als PDF, als Word-Dokument, als Textdatei. So können Lernende es mit ihren eigenen Hilfsmitteln nutzen.
Und wenn du unsicher bist? Frag deine Studierenden. Einfach so: „Welche Schwierigkeiten habt ihr mit meinen Materialien?“ Du wirst überrascht sein, wie offen sie antworten - wenn du es respektvoll und ohne Druck fragst.
Was kommt als Nächstes? Der Trend zu WCAG 2.2
Die EU hat 2019 die Barrierefreiheitsrichtlinie verabschiedet. Bis 2025 müssen alle öffentlichen digitalen Angebote - also auch Hochschul-Websites, Lernplattformen, digitale Prüfungen - vollständig barrierefrei sein. Und ab 2026 wird WCAG 2.2 verbindlich. Was ändert sich? Neue Kriterien, die besonders für Menschen mit kognitiven Einschränkungen und Nutzenden von Sprachsteuerung wichtig sind: z. B. die Möglichkeit, Eingaben abzubrechen, oder die Vermeidung von Zeiten, in denen sich Inhalte automatisch verändern.Das bedeutet: Wer heute mit WCAG 2.1 arbeitet, ist auf dem Weg, veraltet zu sein. Die Technik entwickelt sich. Die Bedarfe der Lernenden auch. Und die Gesetze folgen. Wer jetzt nicht anfängt, wird später Nachteile haben - nicht nur rechtlich, sondern auch pädagogisch.
Die FAU Erlangen-Nürnberg sagt es klar: „Eine vollständige Barrierefreiheit ist nicht immer machbar. Aber eine möglichst barrierearme Zugänglichkeit ist ein Mindeststandard.“ Das ist der richtige Ansatz. Nicht Perfektion. Nicht Überforderung. Aber Engagement. Jeder Schritt zählt.
Muss ich alle Materialien barrierefrei gestalten, auch wenn niemand eine Behinderung hat?
Ja. Denn du weißt nicht, wer deine Materialien nutzt. Eine Studierende mit einer unsichtbaren Erkrankung könnte gerade in deiner Gruppe sitzen. Oder jemand, der nach der Geburt seines Kindes müde ist und schlecht sehen kann. Barrierefreiheit ist kein Sonderangebot - sie ist eine Grundvoraussetzung für inklusive Bildung. Und sie hilft allen - auch den, die es nicht merken.
Ist es teuer, barrierefreie Inhalte zu erstellen?
Nein. Die meisten Maßnahmen kosten keine Gelder, sondern Zeit und Wissen. Du brauchst keine teure Software. Kostenlose Tools wie WebAIM Contrast Checker, YouTube-Untertitel oder Adobe Acrobats Barrierefreiheitsprüfung reichen aus. Der größte Aufwand liegt darin, alte Materialien umzubauen. Aber wenn du von Anfang an barrierefrei arbeitest, wird es immer einfacher.
Was ist mit KI-Tools, die Texte oder Videos automatisch anpassen?
KI kann helfen - aber sie ersetzt nicht menschliche Überprüfung. Eine KI kann Untertitel generieren, aber sie versteht keinen Kontext. Sie kann einen Text vereinfachen, aber sie macht aus einer wissenschaftlichen Erklärung oft eine ungenaue Zusammenfassung. Nutze KI als Unterstützung, nicht als Lösung. Prüfe immer, ob das Ergebnis wirklich verständlich und korrekt ist.
Wie kann ich meine Kolleg:innen dazu bringen, mitzumachen?
Zeige nicht den Mangel, zeige die Lösung. Zeige ihnen, wie einfach es ist, einen PDF-Text mit Überschriften zu formatieren. Zeige ihnen, wie man mit einem Klick Untertitel in ein Video einfügt. Teile deine Erfolge: „Ich habe meine Folien barrierefrei gemacht - und jetzt können alle sie auch auf dem Handy lesen.“ Mach es sichtbar. Mach es einfach. Und mach es zur Norm.
Gibt es Schulungen oder Unterstützung an meiner Hochschule?
Viele Hochschulen in Deutschland haben mittlerweile Barrierefreiheitsbeauftragte oder Zentren für digitale Lehre. Suche nach „Barrierefreiheit“ oder „Inklusion“ auf deiner Hochschulwebsite. Oder frag bei der Studierendenvertretung nach. Oft gibt es Workshops, Checklisten oder Ansprechpersonen - nur wissen viele nicht, dass sie existieren. Frag einfach.






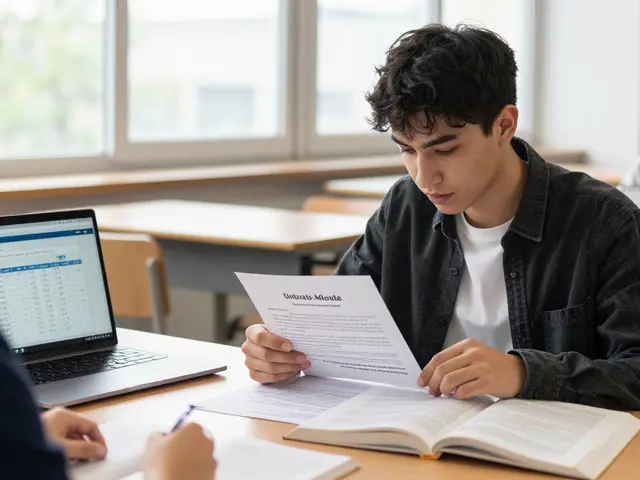
15 Kommentare
Jade Robson
Ich hab letzte Woche ein Skript umgebaut – nur weil eine Studierende gesagt hat, sie kann die PDFs nicht lesen. Jetzt nutzt fast die ganze Gruppe die neuen Dateien, auch die ohne Behinderung. Einfach nur Überschriften richtig setzen und Alternativtexte schreiben. Kein Zauber, aber es fühlt sich an, als würde man endlich Menschen statt Dokumente unterrichten.
Matthias Kaiblinger
Das ist wieder so ein typischer DE-Gutmensch-Quatsch. Wer sich nicht an die Regeln hält, soll eben nicht studieren. Warum muss ich für Leute, die nicht mal eine Tastatur bedienen können, meine ganze Vorlesung umkrempeln? Ich lehre Jura, nicht inklusive Kinderkrippe. WCAG 2.1 reicht völlig. Wer’s nicht schafft, soll sich in die Ecke stellen und mit dem Finger auf den Bildschirm klopfen.
Kari Viitanen
Ich komme aus Norwegen, wo diese Themen seit Jahren institutionalisiert sind. Es ist nicht nur eine rechtliche Verpflichtung, sondern eine kulturelle Haltung. In Deutschland scheint es oft so, als würde man Barrierefreiheit als Belastung sehen – dabei ist sie ein Ausdruck von Respekt. Die Technik ist verfügbar. Es fehlt nur die systematische Umsetzung. Und das ist eine Frage der Prioritätensetzung, nicht der Ressourcen.
Quinten Peeters
Ich hab das ganze Zeug gelesen. Und ich sage: Scheiß drauf. Ich mach’s wie immer. Wenn jemand was braucht, soll er sich melden. Ich hab keine Zeit, für jeden einzelnen eine eigene Version zu basteln. Das ist kein Unterricht, das ist ein Service-Portal.
Jutta Besel
Das ist ja mal wieder ein einziger Grammatik-Albtraum. „Stell dir vor“ – das ist kein Satz, das ist ein Dialekt-Schrei. Und „hier klicken“ – warum schreibt man das nicht mit Großbuchstaben? Und „16 Prozent“ – das ist falsch, es muss „16 %“ heißen, sonst ist das unprofessionell. Und wer sagt „Moodle-Kurs“? Das ist eine Marke, nicht eine Kategorie. Aber egal. Die Inhalte sind eigentlich gut. Nur die Sprache… ach, vergiss es.
Matthias Papet
Ich hab vor zwei Semestern angefangen, alle Videos mit Untertiteln zu versehen – einfach mit YouTube. Hat 20 Minuten pro Video gekostet. Und seitdem kommen viel mehr Leute zu den Nachbesprechungen. Auch die, die vorher nie was sagten. Ich hab neulich eine Studentin getroffen, die hat mir gesagt, sie hätte erst jetzt verstanden, worum es in der Vorlesung ging. Das ist kein Bonus. Das ist Bildung. Und das ist der Grund, warum ich das mache. Nicht weil’s Pflicht ist. Sondern weil’s Sinn macht.
Malte Engelhardt
Die 5 Säulen sind perfekt zusammengefasst. Ich arbeite als Barrierefreiheitsberater an einer Uni und kann bestätigen: Die meisten Lehrenden wissen nicht mal, dass Adobe Acrobat eine Prüfungsfunktion hat. Die meisten denken, „barrierefrei“ heißt „mit Bildschirmleser kompatibel“. Aber es geht um die gesamte Nutzererfahrung – von der Farbwahl bis zur Tastaturnavigation. Und ja, WCAG 2.2 ist der nächste Schritt. Besonders die Kriterien zu „Eingabe abbrechen“ und „nicht automatisch wechselnde Inhalte“ werden viele überraschen. Aber: Es lohnt sich. Die Zeit, die man jetzt investiert, spart später doppelte Arbeit.
Thomas Schaller
Barrierefreiheit ist ein Mythos. Wer nicht mit der Technik mithält, hat das Studium nicht verdient. Die Welt ist nicht dafür gemacht, dich zu umarmen. Lerne, mit den Mitteln umzugehen, die du hast. Oder geh in die Werkstatt. Nicht jeder kann alles haben. Das ist Realität.
Christoph Landolt
Es ist bemerkenswert, wie die Gesellschaft den Begriff der Gleichheit performativ entleert, um ihn als moralischen Selbstzweck zu instrumentalisierten. Barrierefreiheit wird hier nicht als Recht, sondern als emotionales Opferkult-Paradigma verhandelt. Die UN-BRK ist kein Gesetz, sondern eine hermeneutische Konstruktion. Wer sie als normative Grundlage akzeptiert, verkennt die ontologische Differenz zwischen technischer Zugänglichkeit und existenzieller Teilhabe. Die WCAG 2.2 ist lediglich ein Symptom der postmodernen Bildungskrise – eine Verdinglichung der Differenz.
Alexander Cheng
Ich hab mal einen Kollegen gefragt, warum er keine Alternativtexte schreibt. Er hat gesagt: „Weil ich keine Ahnung hab, was drauf ist.“ Das war der Moment, wo mir klar wurde: Es geht nicht um Technik. Es geht darum, dass Lehrende nicht wissen, wie sie ihre eigenen Materialien sehen. Wir brauchen keine Schulungen über WCAG. Wir brauchen Schulungen, die fragen: „Wie würdest du das lesen, wenn du nicht sehen könntest?“ Oder wenn du nur eine Hand hast? Oder wenn du jeden Tag Angst hast, dass du versagst? Das ist das, was zählt. Nicht die Kontrastwerte. Sondern die Empathie.
price astrid
Barrierefreiheit ist ein Konstrukt der Linken, das die Leistungsgesellschaft abschafft. Wer nicht perfekt ist, soll halt nicht studieren. Ich hab 50 Seiten PDFs mit 2000 Fachbegriffen geschrieben. Wenn jemand das nicht schafft, ist das sein Problem. Nicht meins. Wer will, dass alles leicht ist, soll in die Kita gehen.
Andreas Krokan
Ich hab neulich nen Studenten mit Dyslexie gefragt, was ihm am meisten hilft. Er hat gesagt: „Keine langen Sätze. Keine Fremdwörter. Und bitte keine blöden Pfeile, die nur als „hier“ stehen.“ Ich hab das übernommen. Und jetzt verstehen alle mehr. Auch die ohne Dyslexie. Einfach nur klarer schreiben. Kein Zauber. Kein Aufwand. Nur Respekt.
Stephan Schär
Leute, ich hab neulich einen PDF-Ordner von meiner Kollegin gesehen. 12 Dateien, kein H1, kein Alt-Text, alles mit „Bild 1“ beschriftet. Ich hab’s einfach korrigiert – in 15 Minuten. Und jetzt läuft alles. Kein Stress. Kein Drama. Und sie hat mir sogar Kaffee gebracht. 😊
Joel Lauterbach
Ich hab die Checkliste aus dem Artikel als PDF erstellt und an alle Lehrenden geschickt. Keine Email. Kein Meeting. Nur die Liste. 37 von 52 haben sie gelesen. 19 haben sie umgesetzt. Das ist mehr, als alle Schulungen in den letzten 5 Jahren gebracht haben.
Dieter Krell
Ich hab das letzte Semester mit 3 Studierenden mit psychischen Erkrankungen gearbeitet. Keine extra Regeln. Keine Sonderbehandlung. Nur: klare Struktur, vorhersehbare Fristen, und ich hab gesagt: „Wenn du nichts schickst, ist das okay. Sag einfach Bescheid.“ Sie haben alle bestanden. Und sie haben mir geschrieben: „Du hast uns das Gefühl gegeben, nicht nur ein Fall zu sein.“ Das ist der Unterschied. Nicht die Technik. Die Menschlichkeit.