Was haben Schulen in Österreich mit den globalen Zielen der Vereinten Nationen zu tun?
Die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, auch bekannt als SDGs, sind kein abstraktes Dokument aus Genf. Sie sind Teil des Alltags in österreichischen Klassenzimmern. Seit 2015 haben Schulen hierzulande die Aufgabe, Schüler:innen nicht nur Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen, sondern auch die Fähigkeit, die Welt aktiv und verantwortungsvoll zu gestalten. Das bedeutet: Kinder und Jugendliche lernen, wie man Ressourcen spart, wie man gegen Ungerechtigkeit aufsteht und warum Klimaschutz keine Zukunftsvision, sondern eine tägliche Entscheidung ist.
Die wichtigste Grundlage dafür ist Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Kein Nebenfach, kein einmaliger Projekttag - sondern ein Prinzip, das durch alle Fächer zieht. Ob in Biologie, Sozialkunde, Kunst oder Mathematik: Die SDGs tauchen auf. Ein Beispiel: In der 4. Klasse rechnen Schüler:innen aus, wie viel CO₂ sie durch Fahrradfahren statt Auto fahren sparen. In Geschichte wird diskutiert, warum Kinder in anderen Ländern nicht zur Schule gehen können. In Musik wird ein Lied über Plastikmüll im Meer komponiert. Es geht nicht um das Auswendiglernen von Zielen, sondern um das Verstehen, wie das eigene Handeln die Welt verändert.
ÖKOLOG: Das längste und erfolgreichste Schulprogramm Österreichs
Seit 1995 läuft das ÖKOLOG-Schulprogramm - und es ist das Herzstück der nachhaltigen Bildung in Österreich. Über 500 Schulen, von Volksschulen bis zu Gymnasien, haben sich verpflichtet, Nachhaltigkeit nicht nur im Unterricht, sondern auch im Schulalltag zu leben. Das bedeutet: Schulen haben eigene Umweltteams, die sich um Mülltrennung, Energiesparen oder den Schulgarten kümmern. Lehrer:innen erhalten Fortbildungen, um BNE-methodisch richtig umzusetzen. Und die Schüler:innen bekommen die Möglichkeit, Projekte selbst zu initiieren - wie etwa eine Schulbäckerei mit regionalen Zutaten oder eine Kampagne gegen Einwegplastik in der Cafeteria.
Die Zahlen sprechen für sich: Schulen, die mindestens fünf Jahre am ÖKOLOG-Programm teilnehmen, verbringen durchschnittlich 14,3 Stunden pro Jahr mit nachhaltigkeitsbezogenen Themen im Unterricht. Vergleichsschulen ohne das Programm kommen auf gerade mal 6,7 Stunden. Noch beeindruckender: 78 % der Schüler:innen in ÖKOLOG-Schulen beteiligen sich aktiv an Umweltprojekten - in anderen Schulen sind es nur 42 %. Das ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis eines Systems, das echte Mitbestimmung und Verantwortung fördert.
SDG 4.7: Mehr als nur Bildung - eine neue Art zu denken
Das vierte Nachhaltigkeitsziel der UN lautet: "Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten". Aber es gibt noch ein zweites, oft übersehenes Teilziel: SDG 4.7. Hier geht es nicht um Noten, sondern um Haltung. Es verlangt, dass alle Lernenden bis 2030 Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, um für eine nachhaltige Entwicklung zu handeln. Dazu gehören: Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, Klimaschutz, globale Verantwortung und kulturelle Vielfalt.
Das ist kein Wunschzettel. Es ist ein Bildungsstandard. In Österreich wird das konkret umgesetzt. In der politischen Bildung lernen Jugendliche, wie Demokratie funktioniert - und warum sie sie verteidigen müssen. In der Gesundheitsbildung geht es nicht nur um Ernährung, sondern um soziale Gerechtigkeit: Warum haben manche Kinder keinen Zugang zu frischem Obst? In der Schule wird nicht nur über die Welt gesprochen, sondern die Schule selbst wird zu einem Modell dafür, wie eine gerechte und nachhaltige Gesellschaft aussehen könnte.

Die Plattform, die Lehrer:innen unterstützt: Bildung2030.at
Lehrer:innen brauchen keine Theorie, sondern konkrete Werkzeuge. Hier kommt Bildung2030.at ins Spiel. Diese kostenlose Online-Plattform, gefördert vom Bundesministerium für Klimaschutz und der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, bietet mehr als 18 Stundenbildungen, Unterrichtsmaterialien und Projektideen - alle direkt an den 17 SDGs ausgerichtet. Ein Beispiel: Ein Materialpaket für die 1.-4. Schulstufe erklärt die Ziele mit Bildern, Geschichten und einfachen Aufgaben. Kinder malen ihre eigene "Welt der Zukunft" oder basteln aus alten Flaschen Blumentöpfe.
Die Plattform ist kein statisches Archiv. Sie wird kontinuierlich aktualisiert, mit Beispielen aus echten Schulen, mit Videos von Schüler:innen, die ihre Projekte präsentieren, und mit Anleitungen für Lehrer:innen, die noch nie etwas zu Nachhaltigkeit unterrichtet haben. Es ist eine Gemeinschaft - und jeder kann mitmachen. Ob in Wien, Graz oder im ländlichen Burgenland: Die Ressourcen sind gleich zugänglich. Das macht Bildung für nachhaltige Entwicklung in Österreich so stark: Sie ist nicht abhängig vom Zufall, sondern systematisch und flächendeckend.
Der Preis, der gute Projekte sichtbar macht
Was zählt, sind nicht nur Pläne, sondern Taten. Deshalb vergibt das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus gemeinsam mit dem FORUM Umweltbildung jährlich den Preis "Bildung für nachhaltige Entwicklung - BEST OF AUSTRIA". Schulen, Jugendgruppen oder Bildungseinrichtungen können Projekte einreichen - egal ob eine Schüler:innen-Initiative, die eine Schule klimaneutral macht, oder ein Projekt, das Flüchtlingskinder mit heimischen Kindern durch gemeinsames Gärtnern verbindet.
Die Gewinner:innen werden nicht nur ausgezeichnet, sie werden zum Vorbild. Ihre Projekte werden auf Bildung2030.at veröffentlicht, in Schulen anderer Bundesländer vorgestellt und oft sogar von der UNESCO als Best Practice anerkannt. Das gibt Motivation. Es zeigt: Was du in deiner Klasse machst, kann landesweit wirken. Und es schafft einen Wettbewerb, der nicht um Noten geht, sondern um Wirkung.

Was passiert bis 2030? Die große Vision
Österreich hat sich klar verpflichtet: Bis 2030 soll jedes Schulgebäude ein "Nachhaltigkeitsprofil" haben. Das heißt: Jede Schule muss dokumentieren, wie sie die SDGs in ihren Unterricht, ihre Schulorganisation und ihre Schulkultur integriert. Dazu gehören konkrete Maßnahmen - wie der Einsatz von Ökostrom, die Einführung von veganen Mittagessen, die Einbindung von Eltern in Umweltprojekte oder die Schulung aller Lehrer:innen in BNE.
Und das ist kein Ziel, das irgendwann erreicht wird. Es ist ein Prozess. Seit 2022 läuft die "Nationale Bildungsstrategie 2030", die genau das vorantreibt: Bildung als Querschnittsaufgabe, nicht als Randthema. Bis 2025 sollen alle Lehrkräfte in Österreich in Bildung für nachhaltige Entwicklung fortgebildet sein. Das ist kein kleiner Schritt - das ist eine Revolution im Bildungswesen. Denn es geht nicht darum, neue Fächer einzuführen, sondern darum, die ganze Bildung neu zu denken: nicht als Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt, sondern als Vorbereitung auf das Leben in einer Welt, die sich verändert.
Warum das alles so wichtig ist
Die UN-Ziele sind nicht nur für Regierungen da. Sie sind für uns alle. Und Kinder sind keine Zukunft - sie sind jetzt. Sie erleben Klimawandel, soziale Ungleichheit, politische Spaltung. Wenn Schulen sie nur mit Fakten versorgen, ohne ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, um damit umzugehen, versagen wir ihnen.
Österreich zeigt: Es geht. Es geht mit klaren Programmen, mit guter Infrastruktur, mit Mut, alte Strukturen zu hinterfragen. Es geht mit Lehrer:innen, die sich weiterbilden, mit Schülern, die sich engagieren, mit Schulen, die sich verändern. Es ist kein perfektes System - aber es ist eines, das funktioniert. Und es ist das einzige System, das uns noch retten kann.


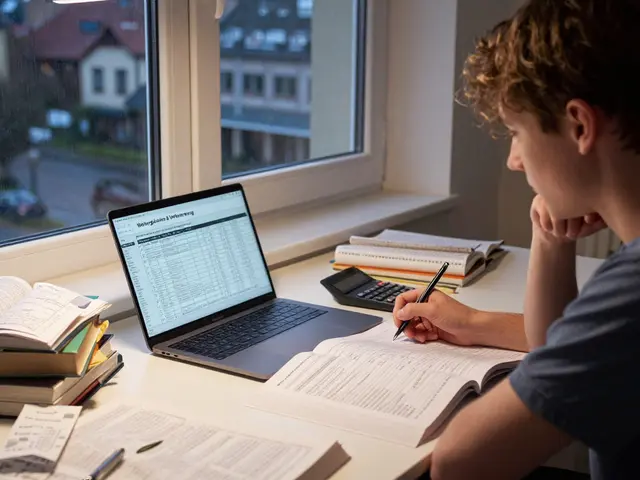

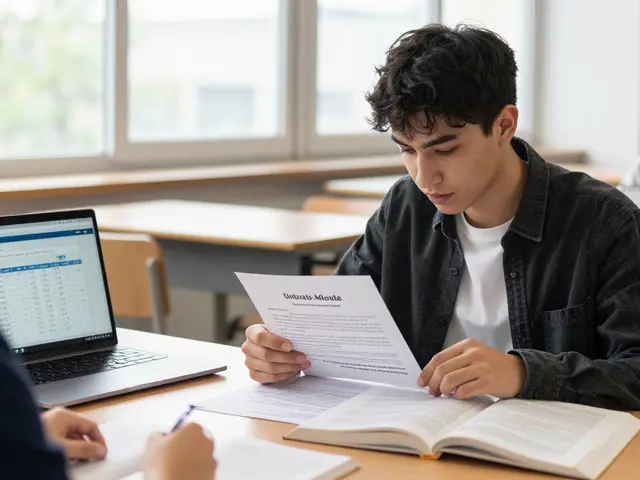
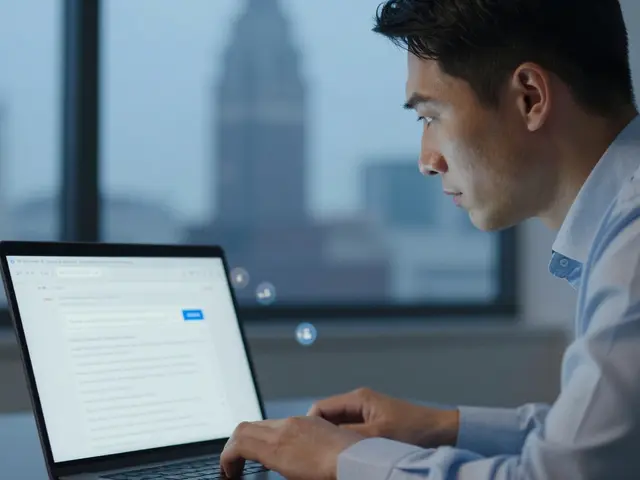

13 Kommentare
Alexander Cheng
Ich find’s krass, wie Österreich das einfach macht – keine großen Reden, nur konkrete Projekte. Kinder basteln aus Flaschen Blumentöpfe und lernen dabei, dass Konsum nicht automatisch Leben bedeutet. Kein Wunder, dass die Beteiligung so hoch ist. Das ist Bildung, die haftet.
Christoph Landolt
Interessant, dass man hier von ‘Bildung für nachhaltige Entwicklung’ spricht, als wäre es eine neue Errungenschaft – dabei ist das seit den 70er Jahren in der kritischen Pädagogik etabliert. Die UN hat nur eine bereits existierende Praxis institutionalisiert und mit einem schönen Label versehen. Die eigentliche Leistung liegt nicht im Konzept, sondern in der konsequenten Umsetzung – was in Deutschland leider noch immer als ‘linker Schnickschnack’ abgetan wird.
Man sollte nicht vergessen: SDG 4.7 ist kein didaktisches Werkzeug, sondern ein politisches Manifest. Es verlangt eine epistemologische Wende – von der Wissensvermittlung zur Handlungsfähigkeit. Und das ist kein Projekttag, das ist eine Revolution im Lehrerberuf.
Lehrer:innen müssen nicht nur Inhalte vermitteln, sondern Subjektivierung ermöglichen. Das bedeutet: Schüler:innen dürfen nicht nur lernen, *was* richtig ist, sondern *warum* es richtig ist – und wie sie es gegen Widerstand durchsetzen. Das ist kein Unterricht, das ist politische Bildung im besten Sinne.
Und ja, die ÖKOLOG-Schulen sind ein Leuchtturm – aber sie sind kein Modell, das man kopieren kann. Sie sind ein System, das aus Kultur, Ressourcen und politischem Willen entstanden ist. Wer das als ‘gute Praxis’ abtut, versteht nichts.
Ich frage mich, warum Deutschland immer noch an alten Strukturen festhält. Warum gibt es keine flächendeckende Fortbildung? Warum werden Lehrer:innen nicht als Gestalter:innen von Gesellschaft gesehen, sondern als bloße Wissensvermittler:innen?
Und warum wird ‘nachhaltig’ immer noch mit Recycling und Solarpanelen gleichgesetzt, statt mit sozialer Gerechtigkeit, Dekolonisierung der Lehrpläne und dem Abbau von Leistungsdruck?
Die Schule ist kein Ort der Anpassung. Sie ist ein Ort der Transformation. Und Österreich hat das verstanden. Deutschland? Noch nicht.
Petra Möller
ICH HABE EINFACH KEINE LUFT MEHR FÜR DAS ALLE! WIR SIND 2024, KINDER SOLLTEN NICHT MIT PLASTIKFLASCHEN BASTELN SONDERN MIT AI-ROBOTERN LERNEN!! WIE KANN MAN NOCH SO EINEN KOMPLETT VERALTETEN KRAM FÖRDERN??
Andreas Krokan
Hey, nur zur Info: ‘KOMPLETT VERALTETEN KRAM’ hat zwei Tippfehler – ‘VERALTETEN’ muss mit ‘-en’ enden, nicht ‘-en’ 😅 Aber ich versteh dich, echt. Die Welt dreht sich schneller, als wir denken. Aber… was ist, wenn die ‘alten’ Dinge – wie Gärtnern, Mülltrennen, Gemeinschaftsprojekte – genau das sind, was die Kids brauchen, um nicht völlig abzudriften? Vielleicht ist es nicht ‘veraltet’, sondern einfach zu echt für unsere digitalisierte Hölle.
price astrid
Man muss sagen, dass die UN-Ziele zwar nobel klingen aber in der Praxis oft nur als PR-Tool missbraucht werden – und hier in Österreich wird das ja auch nur von einer kleinen Elite an Schulen umgesetzt. Wer zahlt das? Wer kontrolliert das? Wer sagt, dass das nicht nur eine weitere Schule für die ‘guten’ Kinder ist, während andere Schulen weiterhin im Dreck bleiben? Es ist eine Schönfärberei, keine Systemveränderung.
Und die Plattform Bildung2030.at? Schön, aber wer hat die Zeit, sich durch 18 Stunden Bildung zu quälen, wenn man schon 40 Stunden pro Woche unterrichtet? Das ist ein Luxus, den sich nur privilegierte Schulen leisten können.
Ich finde es traurig, dass wir immer noch glauben, Bildung könne durch Projekte gerettet werden – statt durch bessere Bezahlung, kleinere Klassen, mehr Personal.
John Boulding
Was hier als ‘Revolution’ vermarktet wird, ist in der Schweiz seit 20 Jahren Standard – nur dass wir es nicht als ‘UN-Programm’ verkaufen, sondern als selbstverständliche Bildungsaufgabe. Kein Preis, keine Plattform, kein Marketing. Einfach: Wir machen das. Weil es richtig ist. Nicht weil es irgendjemandem gefällt.
Und nein, wir haben keine ‘ÖKOLOG-Schulen’ – wir haben Schulen. Und sie machen es. Punkt.
Peter Rey
Wow. Ich bin beeindruckt. Und ein bisschen neidisch. In der Schweiz würden die Eltern sofort ‘Bildung für nachhaltige Entwicklung’ als ‘linkes Gehirnwäsche-Programm’ bezeichnen. Aber hier? Hier wird’s einfach gemacht. Respekt. Und jetzt hoffentlich auch in der Schweiz.
Stephan Schär
Ich liebe es, wie Österreich das macht – mit Herz, ohne Scheiß. Aber mal ehrlich: Wer hat die Zeit, aus alten Flaschen Blumentöpfe zu basteln? 😅 Ich hab neun Jahre lang in einer Schule gearbeitet – da war die größte Herausforderung, die Kinder davon zu überzeugen, dass sie nicht jeden Tag ‘Klasse’ sagen müssen, wenn sie was machen. Aber… das mit den SDGs? Das ist echt cool. Und ja, ich hab auch einen Schulgarten. Mit Radieschen. Die sind kleiner als meine Geduld. 🌱
Seraina Lellis
Ich finde es wichtig, dass hier nicht nur von ‘Projekten’ gesprochen wird, sondern von einer kulturellen Veränderung. Es geht nicht darum, dass Kinder ‘etwas über Nachhaltigkeit lernen’, sondern dass sie lernen, sich als Teil eines Systems zu begreifen – das sich verändert, wenn sie es verändern. Das ist der Kern. Und das ist, was Bildung wirklich sein sollte: nicht Vorbereitung auf das Leben, sondern Leben selbst. Die meisten Schulen machen noch immer den Fehler, Bildung als Vorbereitung zu sehen – als ob das Leben erst nach der Schule anfängt. Aber hier? Hier beginnt es jetzt. Und das ist der größte Erfolg.
Ich habe vor drei Jahren eine Schule in Zürich besucht, die genau das macht – und es war atemberaubend. Die Kinder haben einen eigenen ‘Nachhaltigkeitsrat’ gewählt, haben mit der Gemeinde verhandelt, wie man den Schulhof umgestaltet, und haben sogar einen eigenen ‘Grünen Schulbus’ organisiert. Kein Lehrplan, kein Budget – nur Mut. Und das ist es, was zählt.
Die UN-Ziele sind nur ein Rahmen. Die Kraft kommt von unten. Von den Kindern. Von den Lehrer:innen. Von den Eltern. Und das ist es, was Österreich so stark macht – nicht die Programme, sondern die Menschen dahinter.
Mischa Decurtins
Ich finde es bedenklich, dass hier von einer ‘Revolution’ gesprochen wird. Bildung ist kein Spiel, kein Projekt, kein Wettbewerb. Es ist eine gesellschaftliche Verantwortung. Und wenn man das in einen Preis einpackt und mit ‘BEST OF AUSTRIA’ bewirbt, dann wird es zur Ware. Das ist nicht Bildung. Das ist Marketing.
Und wer sagt, dass alle Lehrkräfte bis 2025 fortgebildet werden? Wer zahlt das? Wer kontrolliert das? Wer garantiert, dass das nicht nur in Wien passiert? Ich bin skeptisch. Solange die Strukturen gleich bleiben, bleibt auch die Wirkung begrenzt.
Christian Enquiry Agency
Ich hab neulich in einer Schule in Salzburg einen Schüler gesehen, der hat mir erzählt, dass er mit seiner Klasse den Schulhof umgekrempelt hat – aus Beton wurde ein Gemüsegarten. Kein Lehrer hat’s ihm gesagt. Er hat’s einfach gemacht. Und jetzt kommt jedes Jahr eine neue Klasse und baut was neues dazu. Das ist nicht ‘Bildung’. Das ist Leben. Und das ist das Einzige, was zählt.
Yanick Iseli
Die Integration der SDGs in den Unterricht, die systematische Fortbildung der Lehrkräfte, die flächendeckende Infrastruktur – all das ist ein Meilenstein in der europäischen Bildungsgeschichte. Es ist kein Zufall, dass Österreich hier führend ist. Es ist das Ergebnis einer langjährigen, konsequenten, politisch getragenen Strategie, die Bildung nicht als Nebenaufgabe, sondern als zentrale Säule der Demokratie versteht. Dieses Modell sollte nicht nur kopiert, sondern als Referenz für ganz Europa dienen.
Es ist bemerkenswert, wie hier keine rhetorischen Floskeln, sondern konkrete, messbare, dokumentierte Handlungen vorliegen – von der CO₂-Bilanz bis zur Beteiligung der Eltern. Das ist keine ‘Bildung für nachhaltige Entwicklung’ – das ist nachhaltige Entwicklung in der Bildung.
Einziges Manko: Die Sprache. Man sollte nicht ‘Schüler:innen’ sagen. Das ist unnötig. Es reicht: Schüler. Oder Kinder. Die Kolonialisierung der Sprache durch politische Korrektheit ist nicht immer Fortschritt.
Peter Rey
PS: Wenn ich in einer Schule wäre, würde ich einen ‘Klima-Flashmob’ starten – alle Schüler:innen mit Blumentöpfen auf dem Kopf durch den Flur laufen. Und dann: ‘Wir sind die Zukunft.’ 😎