Wenn du als Wissenschaftler in Deutschland publizierst, bist du fast immer verpflichtet, deine Arbeit offen zugänglich zu machen. Das ist nicht nur ein Trend - es ist eine Regel, die seit Jahren fester Bestandteil der Forschungslandschaft ist. Doch viele verwechseln Open Access mit einfachem Hochladen auf eine Webseite. Dabei geht es um klare Wege, verbindliche Lizenzen und finanzielle Fallgruben, die dir das Leben schwer machen können - wenn du sie nicht kennst.
Was ist Open Access wirklich?
Open Access bedeutet: Jeder kann deine Forschung kostenlos lesen, herunterladen, teilen und nutzen - ohne Anmeldung, ohne Bezahlschranke. Es geht nicht nur ums Lesen. Es geht darum, dass andere deine Ergebnisse weiterverwenden dürfen: für Lehrveranstaltungen, für neue Studien, für politische Entscheidungen. Die Grundlage dafür ist die Berliner Erklärung von 2003, die von über 300 Institutionen weltweit unterzeichnet wurde - darunter fast alle deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen.Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) definiert OA klar: Wer eine DFG-finanzierte Arbeit veröffentlicht, muss sie in einem offenen Format zur Verfügung stellen. Und zwar mit einer Lizenz, die die Wiederverwendung erlaubt - meistens Creative Commons BY (CC-BY). Das heißt: Jeder darf deine Arbeit nutzen, solange du als Autor genannt wirst.
Der Grüne Weg: Veröffentlichen im Repositorium
Der Grüne Weg ist der beliebteste Pfad in Deutschland. Über 78 Prozent der Hochschulen nutzen institutionelle Repositorien wie OPUS4, DSpace oder EPrints. Du publizierst deine Arbeit erst in einer herkömmlichen Zeitschrift - und lädst danach eine Version in dein Uni-Repository hoch.Doch hier lauern die Fallstricke:
- Embargo-Zeit: Viele Verlage verlangen, dass du deine Arbeit erst nach 6, 12 oder sogar 24 Monaten öffentlich machst. Springer Nature erlaubt 12 Monate, Elsevier 24. Wenn du zu früh hochlädst, riskierst du eine Abmahnung.
- Welche Version? Du darfst nicht die fertige PDF-Datei des Verlags hochladen - das ist urheberrechtlich geschützt. Du musst die sogenannte Post-Print-Version nutzen: den finalen Manuskript-Text, nach Begutachtung, aber ohne Layout und Verlagslogo.
- Lizenz: Die meisten Repositorien verlangen CC-BY. Wenn du die Lizenz vergisst, ist deine Arbeit technisch zwar sichtbar - aber rechtlich unsicher.
Die Universitätsbibliothek Hamburg empfiehlt einen einfachen 5-Schritte-Prozess: 1) Prüfe die Verlagsregeln mit SHERPA/RoMEO, 2) Wähle die richtige Version, 3) Warte auf das Embargo, 4) Füge die CC-Lizenz hinzu, 5) Lade hoch. Die erste Veröffentlichung dauert durchschnittlich 8-12 Stunden. Später geht es schneller - aber die Fehlerquote bleibt hoch: 37 Prozent der Wissenschaftler:innen laden die falsche Version hoch, 29 Prozent vergessen die Lizenz.
Der Goldene Weg: Direkt in Open-Access-Zeitschriften
Beim Goldenen Weg publizierst du direkt in einer Open-Access-Zeitschrift - und bezahlst dafür meistens eine Gebühr: den Article Processing Charge (APC). In Deutschland liegt der Durchschnitt bei 1.850 Euro pro Artikel. Das ist teuer - aber es hat Vorteile.Kein Embargo. Kein Suchen nach der richtigen Version. Kein Risiko, gegen Verlagsregeln zu verstoßen. Dein Artikel ist sofort frei zugänglich - und wird von Anfang an von Suchmaschinen und Bibliotheken indexiert. Das erhöht die Sichtbarkeit: Studien zeigen, dass OA-Artikel 47 Prozent mehr Zitierungen erhalten und dreimal häufiger heruntergeladen werden.
Aber Achtung: Nicht alle OA-Zeitschriften sind gleich. Es gibt seriöse, peer-reviewed Journals - und sogenannte Predatory Journals, die nur Geld verdienen, ohne Qualität zu prüfen. Die DFG und die Allianz der Wissenschaftsorganisationen haben eine Obergrenze von 2.000 Euro pro APC festgelegt. Wenn ein Verlag mehr verlangt, wird die Zahlung oft nicht übernommen. Auch das Projekt DEAL hat seit 2023 Vereinbarungen mit 14 großen Verlagen geschlossen - dadurch können deutsche Forscher:innen in über 1.400 Zeitschriften ohne APC publizieren.

Wer zahlt? Die Kostenlast und die Finanzierungslösungen
Die größte Sorge vieler Wissenschaftler:innen ist die Finanzierung. Wer zahlt die APCs? Die Uni? Der Drittmittelgeber? Du selbst?Seit 2014 verlangt die DFG, dass alle geförderten Projekte OA-Publikationen mit Budget für APCs einplanen. Das bedeutet: Du musst die Kosten bereits im Antrag vorsehen. In der Praxis zahlen oft die Universitätsbibliotheken - über zentrale Fonds oder Verträge wie DEAL. Aber nicht alle Hochschulen haben genug Geld. Einige müssen zwischen Disziplinen priorisieren - Naturwissenschaften kommen oft besser weg als Geisteswissenschaften.
2023 lagen die gesamten OA-Kosten in Deutschland bei 62 Millionen Euro - 45 Millionen davon allein für APCs. Bis 2027 könnte sich das auf 98 Millionen Euro verdoppeln. Experten warnen: Wenn nicht mehr Geld in Infrastruktur und Verlagsverträge fließt, drohen Doppelausgaben. Schon 2023 wurden 12 Millionen Euro doppelt gezahlt - einmal für den Zeitschriftenabonnement, einmal für die APC.
Ein neuer Ansatz: Subscribe-to-Open (S2O). Hier zahlen Bibliotheken weiterhin für Abonnements - aber wenn genug Universitäten mitmachen, werden die Artikel frei zugänglich. 17 deutsche Bibliotheken testen dieses Modell seit 2023. Es ist vielversprechend - aber noch experimentell.
Warum lohnt sich Open Access?
Es gibt mehr als nur Pflichten. OA hat echte Vorteile - für dich und für die Wissenschaft.- Größere Reichweite: Deine Arbeit wird von Lehrer:innen, Praktiker:innen, Bürger:innen und Forscher:innen weltweit gelesen - nicht nur von denen, die Zugang zu teuren Abonnements haben.
- Mehr Zitierungen: Studien zeigen: OA-Artikel werden 20-50 Prozent häufiger zitiert. Dr. Lena Wagner vom Max-Planck-Institut für Eisenforschung berichtet: „Mein letzter OA-Artikel bekam 2,8-mal mehr Zitierungen als sein nicht-offener Vorgänger.“
- Transparenz und Reproduzierbarkeit: Andere können deine Daten, Methoden und Ergebnisse prüfen - das stärkt das Vertrauen in die Wissenschaft.
- EU- und DFG-Kompatibilität: Wenn du OA nutzt, erfüllst du automatisch die Anforderungen von Horizon Europe und der DFG. Kein zusätzlicher Aufwand.
Die Akzeptanz unter Wissenschaftler:innen ist hoch: 82 Prozent finden OA sinnvoll. Doch 74 Prozent beschweren sich über die Bürokratie. Die Lizenzen, die Embargos, die Versionen - das ist komplex. Und das ist das größte Problem.
Die größten Fallstricke - und wie du sie vermeidest
Du bist nicht allein, wenn du dich verloren fühlst. Die häufigsten Fehler sind:- Falsche Version hochgeladen: Du hast die Verlags-PDF hochgeladen - nicht den Post-Print. Lösung: Nutze SHERPA/RoMEO, um die Regeln deiner Zeitschrift zu checken.
- Keine Lizenz angegeben: Dein Artikel ist sichtbar - aber niemand darf ihn legal nutzen. Lösung: Setze immer CC-BY oder CC-BY-4.0.
- Embargo ignoriert: Du hast zu früh hochgeladen. Lösung: Warte. Und dokumentiere das Datum der Veröffentlichung in der Zeitschrift.
- Keine Budgetplanung: Du hast keine APCs im Antrag vorgesehen. Lösung: Prüfe immer vor der Einreichung: Wer zahlt? Wie viel? Ist die Uni bereit?
- Verlagsvertrag nicht gelesen: Manche Verträge verbieten sogar das Hochladen von Post-Prints. Lösung: Lies den Vertrag - oder frag deine Bibliothek.
Die Open-Access-Netzwerk-Hotline beantwortet monatlich über 120 Anfragen - die meisten betreffen Lizenzfragen und Vertragsdetails. Nutze die Hilfe. Deine Universitätsbibliothek hat spezielle OA-Berater:innen. Die DINI hat ein offizielles OA-Handbuch. Die Deutsche Nationalbibliothek bietet monatliche Workshops an.

Was ändert sich ab 2024?
Ab dem 1. Januar 2024 gilt das neue Open-Access-Gesetz (OAG). Es schafft bundesweit einheitliche Regeln - endlich. Vorher gab es ein Flickwerk: In Bayern war es anders als in Hamburg, in Baden-Württemberg anders als in Sachsen. Jetzt ist klar: Alle staatlich geförderten Publikationen müssen OA sein.Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) startet im März 2024 den nationalen OA-Monitor. Er soll zeigen, wie viele Artikel wirklich offen sind - und wo es noch hakt. Bis 2025 soll der OA-Anteil bei 75 Prozent liegen. Bis 2027 soll er bei 100 Prozent sein.
Das ist ehrgeizig. Aber machbar. Die Infrastruktur ist da. Die Technik funktioniert. Die Forscher:innen wollen es. Der Schlüssel ist jetzt: Koordination. Keine Doppelausgaben. Kein bürokratisches Chaos. Klare Regeln - und Unterstützung für alle Disziplinen, nicht nur für die Naturwissenschaften.
Frequently Asked Questions
Muss ich wirklich alle meine Artikel offen veröffentlichen?
Ja - wenn du von der DFG, der EU oder einer anderen öffentlichen Einrichtung finanziert wirst. Das ist seit 2014 für DFG-Projekte verpflichtend. Auch bei Horizon Europe ab 2021 gilt das. Für private Förderungen oder Eigenfinanzierung gilt es nicht automatisch - aber viele Hochschulen verlangen es trotzdem als Standard.
Was ist der Unterschied zwischen CC-BY und CC0?
CC-BY (Attribution) bedeutet: Jeder darf deine Arbeit nutzen, solange du als Autor genannt wirst. Das ist die Standardlizenz der DFG und der EU. CC0 (Public Domain) bedeutet: Du gibst alle Rechte auf - niemand muss dich nennen. Das ist selten für wissenschaftliche Artikel - es wird eher für Daten oder Software verwendet. Für Publikationen verwende immer CC-BY.
Kann ich meine Arbeit in einem Repositorium hochladen, wenn sie schon in einer Zeitschrift erschienen ist?
Ja - das ist der Grüne Weg. Aber du musst die richtige Version hochladen: den finalen Manuskript-Text (Post-Print), nicht die PDF des Verlags. Und du musst das Embargo einhalten. Prüfe immer SHERPA/RoMEO, bevor du hochlädst.
Wie teuer ist ein Open-Access-Artikel in Deutschland?
Der Durchschnittspreis liegt bei 1.850 Euro pro Artikel. Die DFG und die Allianz der Wissenschaftsorganisationen haben eine Obergrenze von 2.000 Euro festgelegt. Wenn ein Verlag mehr verlangt, wird die Zahlung oft nicht übernommen. Mit dem Projekt DEAL kannst du in über 1.400 Zeitschriften kostenlos publizieren - ohne APC.
Warum ist Open Access in den Geisteswissenschaften schwieriger?
Weil viele Geisteswissenschaftler:innen Bücher statt Artikel veröffentlichen - und Buchverlage haben oft keine OA-Modelle. Außerdem gibt es weniger APC-fähige Zeitschriften. Deshalb nutzen Geisteswissenschaftler:innen hauptsächlich den Grünen Weg. Aber die Unterstützung für OA-Bücher wächst - mit Projekten wie OAPEN und der Deutschen Nationalbibliothek.
Was kommt als Nächstes?
Die Zukunft von Open Access in Deutschland ist nicht mehr die Frage, ob - sondern wie. Die Technik ist bereit. Die Politik will es. Die Forscher:innen nutzen es. Der nächste Schritt: Konsolidierung. Weniger Fragmentierung. Bessere Koordination zwischen Bund und Ländern. Einheitliche Regeln für Lizenzen, Embargos und Finanzierung.Wenn du heute beginnst, dich mit OA zu beschäftigen - du bist nicht zu spät. Du bist genau richtig. Denn wer heute weiß, wie es funktioniert, wird morgen nicht nur publizieren - er wird die Wissenschaft verändern.

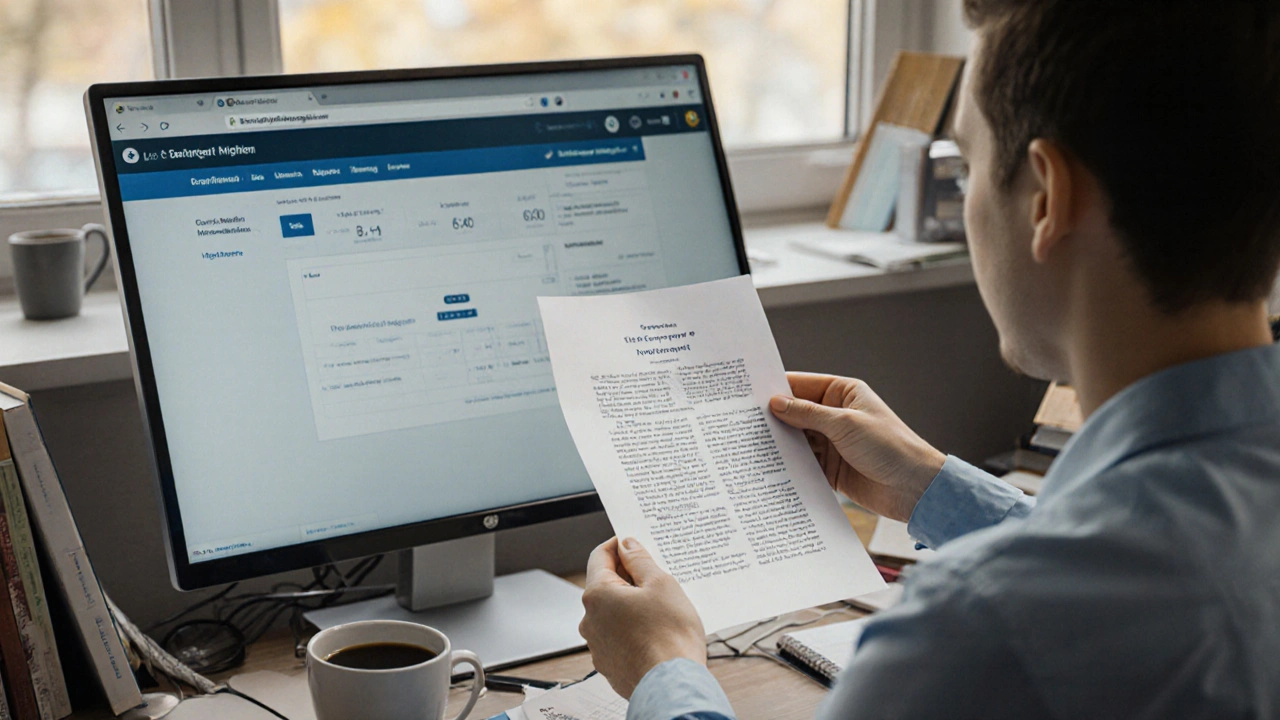



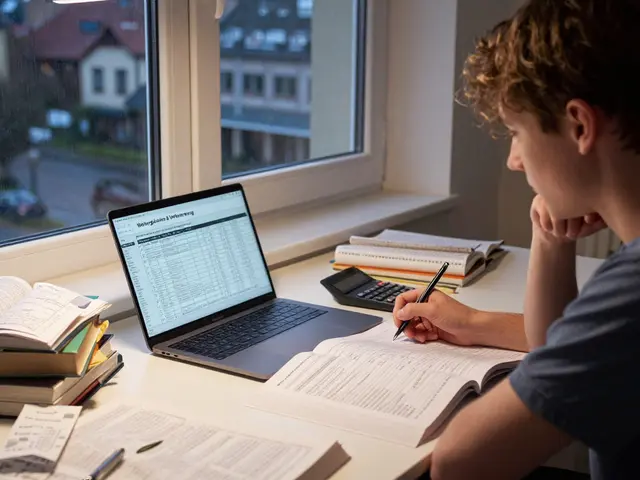
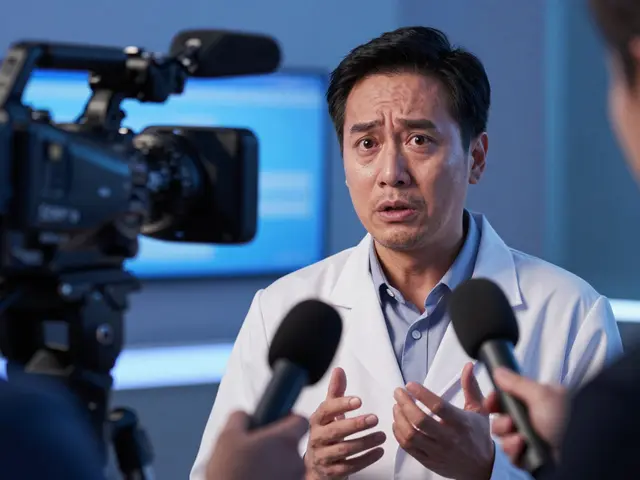
11 Kommentare
Stephan Schär
Also ich find’s krass, dass man immer noch Leute trifft, die denken, OA heißt ‘einfach mal auf ResearchGate hochladen’ 😅 Da wird’s doch langsam Zeit, dass man das in der Uni-Grundausbildung mit aufnimmt – wie ‘Zitieren’ oder ‘Plagiat vermeiden’. Ich hab letztes Jahr ne Post-Print-Version mit CC-BY hochgeladen – und dann kam ne Mail vom Verlag: ‘Hey, das ist nicht die Version, die wir freigegeben haben!’ 😳
Wirklich: SHERPA/RoMEO ist dein bester Freund. Und nein, die PDF vom Verlag ist nicht deine Arbeit – das ist ihr Layout. Deine Arbeit ist der Text. Punkt.
Joel Lauterbach
Genau. Und wer glaubt, APCs seien immer teuer – mit DEAL und S2O ist das in vielen Fällen gar kein Thema mehr. Die Uni-Bibliotheken haben das längst im Griff. Nur diejenigen, die nicht nachfragen, zahlen selbst. Und das ist schade.
Andreas Krokan
Ich hab letzte Woche meinen 3. OA-Artikel abgeschickt – und wieder vergessen, die Lizenz zu setzen. Meine Kollegin hat’s gemerkt, bevor’s hochging. Danke, Lisa! 😅
Leute, macht euch ne Checkliste: 1) Version? 2) Embargo? 3) Lizenz? 4) Budget? 5) Bibliothek informiert? Wenn ihr das habt, läuft’s. Ehrlich.
Dieter Krell
Ich bin aus Berlin, hab Geisteswissenschaften studiert – und dachte, OA ist nur was für Naturwissenschaftler. Bis ich merkte: Meine Dissertation ist von 12 Leuten weltweit gelesen worden – weil sie online war. Eine Lehrerin aus Nepal hat sie für ihren Unterricht genutzt. 🤯
Das ist kein Luxus. Das ist Bildungsgerechtigkeit. Und ja, die Buchverlage sind arschlangsam – aber OAPEN und die DNB helfen. Ich hab mein Buch jetzt bei OAPEN veröffentlicht – und es ist kostenlos verfügbar. Kein Verlag hat mich dafür verklagt. Im Gegenteil: Ein Professor aus Tokio hat mir ne Email geschrieben, wie er’s in seiner Vorlesung verwendet hat. Das ist der Wahnsinn.
Wir müssen aufhören, OA als ‘Bürokratie’ zu sehen. Es ist der einzige Weg, dass Wissenschaft nicht nur für die Elite zugänglich ist. Wer’s nicht versteht, hat einfach noch nie was von einem Studenten aus Kamerun gehört, der keine Uni-Bibliothek hat.
Catharina Doria
Ich hab 2021 einen Artikel in einer OA-Zeitschrift veröffentlicht – mit APC. Die Uni hat gezahlt. Aber dann kam der nächste Antrag – und plötzlich war das Budget aufgebraucht. Warum? Weil die Naturwissenschaftler:innen alle ihre 2000€-APCs durchgezogen haben. Und jetzt? Kein Geld mehr für Geisteswissenschaftler. Kein Support. Keine Workshops. Keine Hilfe.
Das ist kein System. Das ist eine Klassengesellschaft in der Wissenschaft. Und das BMBF redet von ‘Gleichheit’ – aber die Realität? Die Bibliotheken in Bayern haben 3x mehr Budget als die in Sachsen. Und die DFG? Die hat keine Ahnung, wie es in der Praxis läuft. Sie schreibt Richtlinien – und dann ist es die Uni, die den Dreck wegräumt.
Ich hab 8 Jahre gebraucht, um meinen zweiten Artikel zu veröffentlichen. Nicht wegen der Forschung. Sondern wegen der Bürokratie. Und jetzt soll ich noch ‘Open Science’ predigen? Nein. Ich predige: ‘Hört auf, uns zu verarschen.’
price astrid
Die Berliner Erklärung von 2003? Ach ja, die alte, heilige Schrift der Open-Access-Gläubigen. Ich frage mich, ob jemand jemals die epistemologischen Implikationen hinter dieser ‘Freiheit’ reflektiert hat. Wer bestimmt, was ‘nutzbar’ ist? Wer definiert ‘Wissenschaft’? Ist nicht jede Lizenzierung eine Form der Herrschaft? CC-BY ist nicht Neutralität – es ist eine Machtstruktur, die den Autor als ‘Urheber’ fetischisiert, während die kollektive Produktion von Wissen ignoriert wird.
Und dann die ‘Finanzierung’ – oh, wie romantisch, dass die Uni-Bibliotheken die Kosten tragen. Aber wer zahlt die Bibliotheken? Der Steuerzahler. Und wer ist der Steuerzahler? Der Arbeiter. Die Arbeiterin. Diejenigen, die nie eine Publikation lesen werden – aber dafür zahlen, dass Professoren ihre 12. Studie über den Einfluss von Hegel auf die Postmoderne publizieren.
OA ist nicht Befreiung. Es ist die Kommerzialisierung der Intellektualität unter dem Deckmantel der Demokratisierung. Und wir alle spielen mit.
Lieve Leysen
Ich hab’s auch erlebt: Ich hab ne Post-Print hochgeladen – aber die Lizenz vergessen. 😅 Dann kam ne Email von der Uni-Bibliothek: ‘Hey, wir haben’s korrigiert – CC-BY ist jetzt drauf!’ 🙌
So was macht einen Unterschied. Und die Workshops? Die sind echt hilfreich. Ich hab letzte Woche an einem mitgemacht – und endlich verstanden, was ‘Embargo’ bedeutet. Ich dachte, das ist ein neues Kaffeegetränk. 😂
Und ja – Geisteswissenschaftler:innen, ihr seid nicht allein. Wir kämpfen auch. Aber wir sind nicht weniger wichtig. Nur anders. ❤️
Niklas Lindgren
Was für ein Quatsch. Deutschland zahlt Millionen für OA, während unsere Schulen keine Bücher mehr haben. Unsere Kinder lernen in kaputten Klassenräumen – und die Professoren kriegen 2000€ pro Artikel, damit irgendwer in Indien seine 3. Studie über Kaffee-Statistiken lesen kann?!
Wir brauchen keine ‘Open Access’-Gesetze. Wir brauchen ‘Open Doors’ für unsere Kinder. Nicht für die ganze Welt. Für UNS.
Und wer das nicht versteht, ist entweder naiv oder hat nie ein echtes Problem gesehen.
Runa Kalypso
Ich bin aus Norwegen, aber hab in Berlin geforscht – und war total überrascht, wie gut die OA-Infrastruktur hier ist. Die Bibliothekar:innen sind super. Die Workshops? Top. Aber… die Lizenz? Ich hab CC0 gesetzt, weil ich dachte, das ist ‘freier’. 😅 Dann hat mir jemand gesagt: ‘Nein, das ist für Daten, nicht für Artikel.’
Also hab ich’s geändert. Und jetzt ist mein Artikel richtig lizenziert. Danke, Deutschland! 🇩🇪❤️
Brecht Dekeyser
Leute, ich hab letzte Woche meinen 1. OA-Artikel veröffentlicht – und es war total easy. Hab SHERPA/RoMEO genutzt, 12 Monate gewartet, Post-Print hochgeladen, CC-BY drauf, fertig. 🚀
Und jetzt? Mein Artikel ist auf Google Scholar, in der DNB, sogar auf der Uni-Seite von Tokio – und ich hab keine Cent dafür gezahlt. DEAL hat’s übernommen. 🤯
Das ist der Zukunft. Und die ist jetzt. Nutzt sie. 😎
Julia Wooster
Ich habe den Text gelesen – und muss sagen: Es ist erschreckend, wie wenig kritische Reflexion in dieser Diskussion stattfindet. Die ‘Open Access’-Bewegung wird als moralischer Imperativ verkauft – doch wer hat je nach den epistemologischen Konsequenzen gefragt? Wer hat die Machtverhältnisse hinter den Verlagsverträgen untersucht? Wer hat sich gefragt, ob ‘Zitierhäufigkeit’ tatsächlich ein Maß für ‘Wert’ ist?
Die DFG, das BMBF – sie alle agieren als Instrumente einer neoliberalen Wissenschaftspolitik. OA ist kein Fortschritt. Es ist die Vermarktung von Wissen unter dem Deckmantel der Öffentlichkeit. Und diejenigen, die es unterstützen, sind nicht Befreier – sie sind Komplizen.
Ich werde nicht publizieren – solange nicht eine echte Debatte über die Entkapitalisierung der Wissenschaft stattfindet.