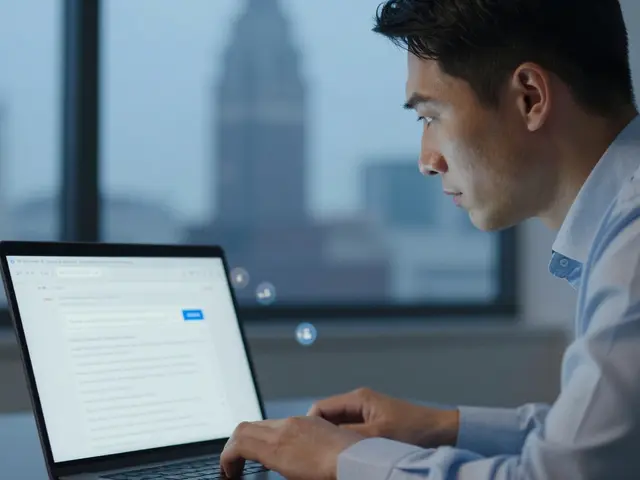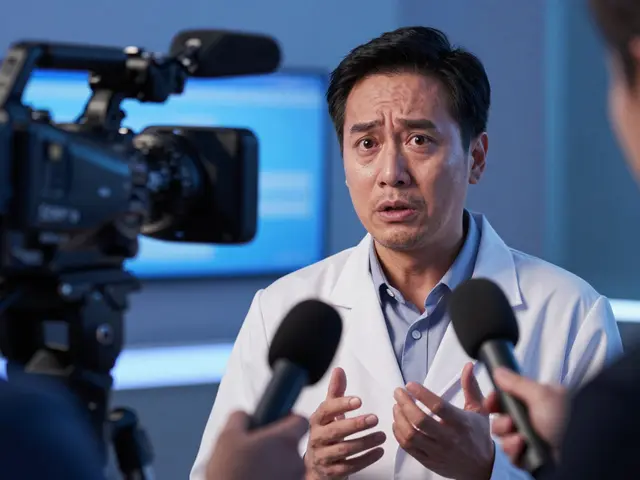Equity-Indikatoren: Was sie messen und warum sie für Bildungsgerechtigkeit entscheidend sind
Equity-Indikatoren, Messgrößen, die ungleiche Chancen in Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft sichtbar machen. Auch bekannt als Chancengleichheitsindikatoren, zeigen sie nicht, wie viele Schüler:innen abschließen – sondern wer abschließt. Sie fragen: Wer hat Zugang? Wer wird ignoriert? Wer braucht extra Unterstützung, um gleich zu starten? Das ist kein abstraktes Konzept. Das ist der Unterschied zwischen einem Kind, das mit Deutsch als Muttersprache in die Schule kommt, und einem, das jeden Tag kämpft, um mitzukommen. Es ist der Unterschied zwischen einer Schule, die Nachteilsausgleich kennt, und einer, der erlaubt, dass Schüler:innen mit LRS oder Dyskalkulie untergehen.
Bildungsgerechtigkeit, die faire Verteilung von Bildungschancen unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Sprache ist das Ziel. Aber wie misst man Gerechtigkeit? Mit Equity-Indikatoren. Sie zeigen, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund in Sprach-Kitas gelangen – oder ob sie in DaZ-Klassen steckenbleiben. Sie zeigen, ob Schüler:innen aus armen Familien tatsächlich an internationalen Studiengängen teilnehmen können – oder ob die Kosten sie ausschließen. Sie zeigen, ob Schulen in Österreich ihre Nachteilsausgleich, rechtliche und pädagogische Maßnahmen, die benachteiligte Schüler:innen unterstützen, damit sie gleiche Chancen haben wirklich umsetzen – oder nur auf dem Papier stehen.
Und es geht weiter. Bildung für nachhaltige Entwicklung, ein Ansatz, der Schüler:innen befähigt, soziale, ökologische und wirtschaftliche Verantwortung zu übernehmen braucht Equity-Indikatoren genauso wie die Schule. Warum? Weil Klimaschutz nicht funktioniert, wenn nur die Reichen mitmachen. Wenn nur Schulen mit Budgets Nachhaltigkeitsberichte schreiben, während andere gar nicht erst anfangen können. Die SDGs, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die auch Bildungsgerechtigkeit als Ziel 4 festlegen verlangen nicht nur Bildung für alle – sondern gute Bildung für alle. Und das geht nur, wenn man sieht, wer fehlt.
Was du hier findest, sind keine abstrakten Theorien. Das sind konkrete Beispiele: Wie eine Schule in Wien mit Citizen Science Daten sammelt, um zu zeigen, dass Kinder aus bestimmten Vierteln seltener an Umweltprojekten teilnehmen. Wie ein Stipendienprogramm in Deutschland seine Auswahlkriterien verändert hat, nachdem Equity-Indikatoren zeigten, dass Motivationsschreiben oft von privilegierten Familien besser vorbereitet werden. Wie Lehrer:innen in Österreich mit Schulpsychologie Eltern beraten, damit Kinder mit LRS nicht als faul abgestempelt werden. Es geht nicht darum, wer mehr weiß. Es geht darum, wer die Chance bekommt, etwas zu lernen.