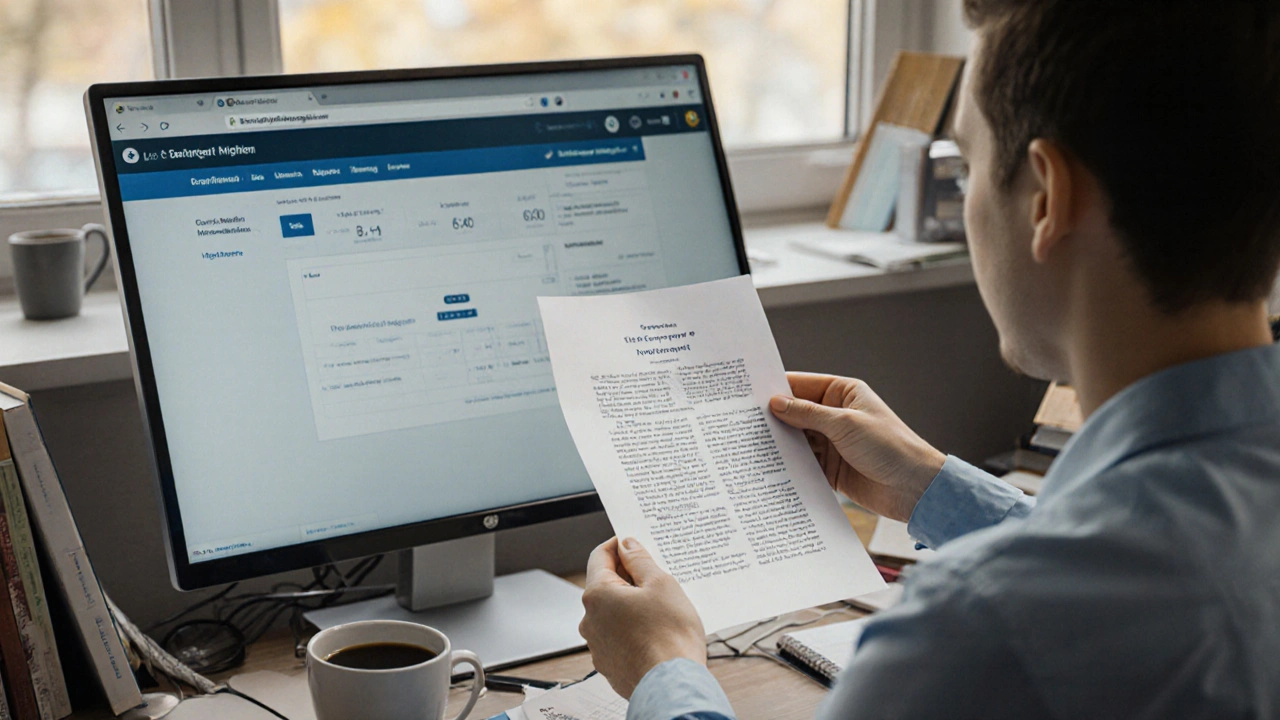OA-Pflichten: Was Sie als Forscher oder Institution in Österreich wissen müssen
Wenn Sie in Österreich forschen, ist Open Access, die verpflichtende kostenlose Veröffentlichung wissenschaftlicher Ergebnisse im Internet. Auch bekannt als OA-Pflichten, ist das kein freiwilliger Bonus – es ist eine Bedingung für jede öffentliche Förderung. Ob Sie an einer Uni arbeiten, ein Projekt mit EU-Geldern finanzieren oder einfach nur Ihre Arbeit publizieren wollen: Die Regeln sind klar. Seit 2021 gilt in der EU, dass alle Projekte, die Geld aus Horizon Europe erhalten, ihre Ergebnisse sofort und frei zugänglich machen müssen. Österreich hat das übernommen – und das betrifft nicht nur große Universitäten, sondern auch KMUs, Forschungsinstitute und sogar Student:innen, die mit Fördergeldern arbeiten.
Diese OA-Pflichten, die Verpflichtung, Forschungsergebnisse öffentlich zugänglich zu machen. Auch bekannt als Open Access, ist ein zentraler Bestandteil moderner Wissenschaft sind nicht nur ein Formular, das man unterschreibt. Sie beeinflussen, wie Sie Ihre Daten speichern, welchen Verlag Sie wählen, und ob Sie Ihre Arbeit in einem Open-Access-Journal veröffentlichen oder in einem Repositorium wie ACONET hochladen. Wer an Horizon Europe teilnimmt, muss zudem einen Data Management Plan, einen verbindlichen Plan, wie Forschungsdaten erfasst, gespeichert und geteilt werden. Auch bekannt als DMP, ist er Teil jeder EU-Förderantrag erstellen – und der muss schon vor Projektstart vorliegen. Das klingt bürokratisch, ist aber praktisch: Es verhindert, dass Daten verloren gehen, und sorgt dafür, dass andere Forscher:innen Ihre Arbeit nachvollziehen und weiterentwickeln können. In Österreich gibt es klare Leitfäden, etwa von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, die helfen, diese Pflichten umzusetzen – ohne dass Sie ein Rechtsanwalt werden müssen.
Die Folgen, wenn Sie die OA-Pflichten ignorieren? Keine weitere Förderung. Punkt. Auch wenn Ihre Arbeit schon veröffentlicht ist – wenn sie nicht in einem Open-Access-Format vorliegt, zählt sie für zukünftige Anträge nicht. Und das ist kein theoretisches Risiko: In Graz, Wien und Innsbruck wurden Projekte bereits zurückgewiesen, weil die Open-Access-Nachweise fehlten. Es geht nicht um Kontrolle – es geht um Transparenz. Forschung, die mit Steuergeldern finanziert wird, gehört der Öffentlichkeit. Und die soll sie auch sehen können. In der Sammlung unten finden Sie konkrete Anleitungen, wie Sie diese Pflichten erfüllen: vom richtigen Verlagswahl über die Nutzung von Repositorien bis hin zu den rechtlichen Grundlagen, die Sie kennen müssen. Sie brauchen keine Angst vor dem Papierkram – hier wird alles verständlich erklärt.